Wer noch einmal eine Waffe in die Hand nimmt, dem soll die Hand abfallen.
Franz Josef Strauß, CSU, 1949 – 1956 Verteidigungsminister
Grünzeug ist auch gut für die Karriere!
Mach was wirklich zählt.
Werbekampagne der Bundeswehr 2025
In ihrem heutigen Zustand ist die Bundeswehr nicht in der Lage, nach einem Austritt aus der NATO eine deutsche Neutralität zu verteidigen. Ebenso wenig vermag Deutschland andere europäische Staaten mitzureißen, gleichfalls aus der NATO auszutreten und ein ausschließlich europäisches Verteidigungsbündnis zu wagen. Dazu müsste der Impuls vor allem von Deutschland als bevölkerungsreichstem und wirtschaftlich stärkstem Staat Europas ausgehen. Die Gründe für diese Hemmnisse und Unzulänglichkeiten liegen tief. Mit ihnen setzen sich die ersten vier Kapitel dieses Teils auseinander.
Weitere sechs Kapitel enthalten eine Beschreibung des heutigen Zustands der Bundeswehr und gehen dabei auf allgemeine Fragen wie die im Zeichen der sogenannten Zeitenwende neu entbrannte Wehrpflichtdebatte, das Sondervermögen sowie die Bemühungen um die Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr ein. In den letzten beiden Kapiteln geht es schließlich um die Reform, welche die Bundeswehr durchlaufen müsste, damit die Bundesrepublik Deutschland aus der NATO austreten kann, sowie die zu ihrer Umsetzung erforderlichen Kosten.
Das letzte Kapitel Reform- und Geldbedarf bildet den Schwerpunkt dieses Teils, auf den alle Überlegungen hinauslaufen. Es gibt dort die Option, die militärischen Erfordernisse für einen NATO-Austritt im Hinblick auf die Truppenorganisation und die Ausrüstung aller Teile der Bundeswehr eingehend zu ergründen. Dazu bieten wir ausführliche Abhandlungen im PDF-Format an, die sich herunterladen oder ausdrucken lassen. Darin werden auch die am Ende zusammengerechneten Kosten im Einzelnen ermittelt. Mit dieser Gestaltung soll es jedem Leser überlassen bleiben, ob er lieber an der Oberfläche bleiben oder sehr tief in die militärische Materie eindringen möchte.
Inhaltsverzeichnis
Geburtsfehler
Der Geburtsfehler der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland ist die Wiederbewaffnungsdebatte, und die Bundeswehr leidet bis heute an diesem Geburtsfehler.
Standpunkt der Bevölkerung
Nach zwei verlorenen Weltkriegen lehnte die deutsche Bevölkerung alles ab, was mit Krieg und Militär zusammenhing. Von ihr aus war an eine Wiederbewaffnung nicht zu denken. Daran änderte auch der Koreakrieg nichts. Zur Jahreswende 1950/51 veröffentlichte Der Spiegel die Ergebnisse einer von ihm durchgeführten Umfrage: 85,1 Prozent waren nicht bereit, wieder Soldat zu werden. 81,5 Prozent waren gegen einen Beitritt zur NATO. 68,4 Prozent erklärten sich gegen eine Wiederbewaffnung, unter welchen Bedingungen auch immer.1

Protest gegen die Wiederbewaffnung am 20. Januar 1955, Foto: Richard Kroll – dpa Bildarchiv
deutschlandfunk.de/vor-65-jahren-das-deutsche-manifest-gegen-die-100.html
Meinungen der Politiker
Die Berufspolitiker passten sich diesem Trend zunächst beflissen an. Franz Josef Strauß (CSU), der wenige Jahre später Verteidigungsminister wurde, tönte damals noch: Wer noch einmal ein Gewehr in die Hand nehmen will, dem soll die Hand abfallen.2
Carlo Schmid erklärte für die SPD: Wir wollen unsere Söhne niemals mehr in die Kasernen schicken, und wenn noch einmal irgendwo der Wahnsinn des Krieges ausbrechen sollte, dann wollen wir eher untergehen und dabei das Bewusstsein haben, dass nicht wir Verbrechen begangen und gefördert haben. In einem wollen wir kategorisch sein: Wir wollen in Deutschland keinen Krieg mehr führen, und wir wollen darum auch keine Vorbereitungen treffen, die das Kriegführen ermöglichen können, weder im politischen noch im wirtschaftlichen Sinne.2
Auch Konrad Adenauer (CDU) gab sich pazifistisch: Wir sind einverstanden, dass wir völlig abgerüstet werden, dass unsere reine Kriegsindustrie zerstört wird … Ja, ich will noch weitergehen, ich glaube, dass die Mehrheit des deutschen Volkes einverstanden wäre, wenn wir wie die Schweiz völkerrechtlich neutralisiert würden.2
Frühe amerikanische Einflüsse
Während die zitierten Äußerungen fielen, war die Wiederbewaffnung seit dem 15. April 1945, noch vor dem Kriegsende, im amerikanischen Außenministerium bereits eine beschlossene Sache. Mit amerikanischer Hilfe sollte Westdeutschland wiederaufgebaut werden und zum Dank die Rolle eines Bollwerks gegen Russland spielen.2,3 Ab 1947 fanden deshalb unter größter Diskretion private Gesprächsrunden politischer und militärischer Fachleute statt. Schon 1948 – vor Gründung der Bundesrepublik – beauftragte Konrad Adenauer den vormaligen General Dr. Speidel mit einer Ausarbeitung über 1. die augenblickliche Unvermeidlichkeit einer Wiederaufrüstung und 2. ihren ungefähren Umfang und Charakter.2,4 Auch der Parteivorstand der SPD sprach sich 1948 für die Einbeziehung Westdeutschlands in ein Militärbündnis nach Art des Brüsseler Paktes aus,2 aber freilich nur im Geheimen, nicht in der Öffentlichkeit.
Verhängnisvolles Interview
Am 3. Dezember 1949 gab Konrad Adenauer als erster, soeben neu gewählter Bundeskanzler der amerikanischen Zeitung Cleveland Plain Dealer ein Interview, in dem er sich für die Schaffung einer europäischen Armee, der auch deutsche Soldaten angehören sollten, aussprach.2,5 Da es damals noch kein Internet gab, war sich Adenauer wahrscheinlich sicher, dass niemand in der Bundesrepublik dieses Interview zur Kenntnis nehmen würde. Gleich am nächsten Tag, am 4. Dezember 1949, sagte er nämlich gegenüber dpa: In der Öffentlichkeit muss ein für allemal klargestellt werden, dass ich prinzipiell gegen eine Wiederaufrüstung der Bundesrepublik Deutschland und damit auch gegen die Errichtung einer neuen deutschen Wehrmacht bin.6 Dummerweise wurde das Interview vom 3. Dezember der Stuttgarter Zeitung bekannt, die am 6. Dezember unter der Überschrift Landsknechte gesucht kommentierte: Die Entwicklung hat jetzt einen Punkt erreicht, an dem die deutsche Öffentlichkeit nicht mehr schweigend zusehen kann.2
Damit war in der bundesdeutschen Öffentlichkeit die sogenannte Wiederbewaffnungsdebatte losgetreten, die in den folgenden fünf Jahren den politischen Diskurs der jungen Bundesrepublik bestimmte.
Heinemann gegen Adenauer
Einzig die Bundestagsfraktion der – nicht zufällig 1956 verbotenen – KPD verlangte, die Frage der Wiederbewaffnung im Parlament offen zu erörtern, was jedoch alle Parteien rechts von der KPD ablehnten.2 Im August 1950 bot Adenauer ohne Rücksprache mit der Bundesregierung und ohne Beteiligung des Bundestags dem amerikanischen Hochkommissar McCloy deutsche Truppen im Rahmen einer internationalen westeuropäischen Armee an. Aus Protest dagegen trat der damalige Innenminister Gustav Heinemann, der später Bundespräsident wurde, am 31. August 1950 zurück.2,7 Die Begründung seiner Entscheidung enthielt alle Gesichtspunkte, um die es in der Debatte ging:
Die Aufstellung deutscher Truppen bedeutet eine schwere Belastung unserer sozialen Gestaltungsmöglichkeiten … Besonders bedeutungsvoll ist die Frage, ob eine westdeutsche Beteiligung auf Russland provozierend wirken würde. Wenn das Wiedererstehen des deutschen Soldaten in Frankreich ein tiefes Missbehagen auslöst, was wird es in Russland auslösen, das den furor teutonicus in besonderem Maße erlebt und ebenfalls nicht vergessen hat? … Ein europäischer Krieg unter unserer Beteiligung wird für uns nicht nur ein nationaler Krieg sein wie für die anderen betroffenen Völker, sondern obendrein ein Krieg von Deutschen gegen Deutsche. Er wird sich, so wie die Dinge liegen, auf deutschem Boden abspielen … Aber wir legitimieren unser Deutschland selbst als Schlachtfeld, wenn wir uns in die Aufrüstung einbeziehen.2,8

Gustav Heinemann als Bundespräsident,
Bundesarchiv, Bild 146-2007-0037/Georg BauerCC-BY-SA
Ohne mich!
Zunächst spontan entstand Ende 1950 die Ohne-mich-Bewegung. Erst waren es vor allem Kriegswitwen, Kriegswaisen und Invaliden, die Protestbriefe schrieben und Versammlungen veranstalteten, doch bald nahmen die Aktionen organisierte Formen an und wuchsen im Laufe der Jahre 1951/1952 in eine breite Bewegung für eine Volksbefragung zur Wiederbewaffnung und für den Abschluss eines Friedensvertrages hinüber. Fünfzehn Meinungsumfragen aus dem Jahr 1950 belegen die breite Ablehnung der Wiederaufrüstung in der westdeutschen Bevölkerung. Im Januar 1950 fragte das Emnid-Institut: Würden Sie es für richtig halten, wieder Soldat zu werden, oder dass Ihr Sohn oder Ihr Mann wieder Soldat werden würde? 74,5 Prozent der Befragten antworteten mit Nein.2,9
Volksbefragung durch das Volk
Es bildete sich ein breites Aktionsbündnis aus verschiedensten Teilen der Gesellschaft, das von Adenauer eine Volksbefragung über die Frage der Wiederbewaffnung verlangte. Adenauer, dem natürlich klar war, dass drei Viertel mit nein abstimmen würden, lehnte ab, das Grundgesetz sehe keine Volksbefragungen vor.10 Darauf veranstaltete das Aktionsbündnis die Volksbefragung selbst. Es wurden bundesweit örtliche Ausschüsse gebildet, die entweder von Tür zu Tür gingen oder vor Fabriken an jede Schicht Stimmzettel verteilten, die sie am Schichtende mit Urnen wieder einsammelten. Dabei erschien meist die Polizei und beschlagnahmte die Urnen.2 Dadurch kam die Aktion zwar nach und nach zum Erliegen, doch verschaffte sie dem Anliegen schon große Aufmerksamkeit und brachte auch Ergebnisse hervor, über die sich demokratische Politiker kaum hinwegsetzen konnten:
Im März 1952 veröffentlichte das Bündnis einen Schlussbericht. Danach wurden 71.812 Befragungsaktionen in Betrieben, Stadtteilen und Dörfern durchgeführt. Es gab 6.136 öffentliche Versammlungen und Kundgebungen. Dazu kamen gewerkschaftliche Urabstimmungen, Entschließungen von Organisationen und Umfragen von Zeitungen und Universitäten. Dabei sprachen sich 9.119.667 Personen in der Bundesrepublik, im Saargebiet und West-Berlin für den sofortigen Abschluss eines Friedensvertrages und gegen jede Remilitarisierung aus. In persönlicher Abstimmung bejahten von 6.267.302 Befragten auf Versammlungen und Kundgebungen auf in Urnen eingesammelten Stimmzetteln 5.917.683 (94,41 Prozent) dieselbe Forderung.2,10

Demonstration gegen die Wiederbewaffnung 1955 in Bonn, Foto Georg Brock dpa/picture-alliance auf deutschlandfunkkultur.de
Adenauers Reaktion
Gegen die Volksbefragungsaktion gab es innerhalb von zwölf Monaten 8.781 polizeiliche Einsätze, bei denen 7.331 Helfer verhaftet und mehr als 1.000 Gerichtsverfahren eingeleitet wurden.2,11
Um eine rechtliche Grundlage für dieses scharfe Vorgehen zu schaffen, wurde am 11. Juli 1952 eilig das als Blitzgesetz bekannt gewordene Strafrechtsänderungsgesetz verabschiedet, welches die Strafbestände des Hoch- und Landesverrates erheblich erweiterte. Bei einer Vielzahl darauf folgender Prozesse machten die Gerichte von den ihnen damit zur Verfügung gestellten Handlungsspielräumen reichlich Gebrauch.2,12 Mit dem Vorwurf der Wühlarbeit wurde in vielen Urteilen ein Begriff übernommen, mit dem schon während des Nationalsozialismus drakonisches Vorgehen gegen jede Art von Widerstand gerechtfertigt worden war.2 Die Logik der juristischen Subsumtion lautete: Wer gegen die Wiederbewaffnung ist, muss ein Kommunist sein, und wer Kommunist ist, ist zwangsläufig bestrebt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen und somit des Hochverrats schuldig.
Wahrnehmung im Ausland
Adenauers öffentlicher Standpunkt hatte sich währenddessen erheblich verändert. Nach seiner Auffassung waren alle, die für ein neutrales Deutschland eintraten, entweder Dummköpfe oder Verräter.2
Die Niederländer Rudy Kousbroek fasste Adenauers Antikommunismus 1954 in der Feststellung zusammen, dass man sich nicht mehr auf das Bekämpfen des Kommunismus beschränkt, sondern dass man das, was man bekämpfen will, Kommunismus nennt.2,13
Der britische Hochkommissar, Sir Ivone Kirkpatrick, berichtete in einem geheimen Memorandum an seine Regierung: Der Grund dafür (für Adenauers Repressionen) sei schlicht, dass er kein Vertrauen zum deutschen Volk habe. Ihn treibe die Furcht um, dass sich, wenn er einmal nicht mehr da sei, eine deutsche Regierung auf ein Geschäft mit den Russen auf Kosten der Deutschen einlassen könnte. Er habe daraus für sich den Schluss gezogen, dass die Integration Westdeutschlands in den Westen wichtiger sei als die Wiedervereinigung.2,14
Fortsetzung der Proteste
Die Proteste rissen auch nach der Volksbefragung nicht ab. Die SPD kündigte zur Jahreswende 1954/55 ein Kampfjahr gegen die Remilitarisierung mit 6.000 Veranstaltungen, Kundgebungen, Schweigemärchen und Fackelzügen im gesamten Bundesgebiet an. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund unterstützte die Protestbewegung mit zahlreichen Kundgebungen und Veranstaltungen.2
Am 29. Januar 1955 trat in der Frankfurter Paulskirche eine Versammlung der Gegner der Wiederbewaffnung zusammen. Sie repräsentierte ein breites Bündnis. Dazu gehörten der DGB-Vorsitzende Walter Freitag, der SPD-Vorsitzende Erich Ollenhauer, Gustav Heinemann, die Professoren Helmut Gollwitzer, Renate Riemeck und Alfred Weber. Die Versammlung verabschiedete das Deutsche Manifest, das in den Pariser Verträgen die Gefahr einer vertieften Spaltung Deutschlands und die Verschärfung der Kriegsgefahr in Europa sah.2
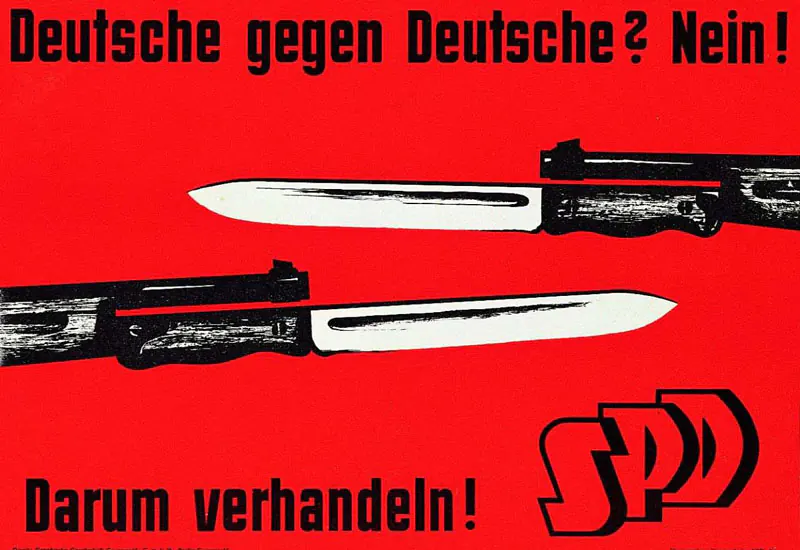
Plakat der SPD
Die Rolle der SPD war allerdings über die gesamte Debatte hinweg zweischneidig. Einerseits trat sie offen gegen die Wiederbewaffnung ein und machte sich zum politischen Sprachrohr der Opposition. Andererseits gab es auch in ihren Kreisen – siehe oben – durchaus Überlegungen, wieder eine Armee aufzubauen. Manche Stimmen aus der Friedensbewegung unterstellten ihr nachträglich, es sei ihr bei ihrem Engagement nur um Wählerstimmen gegangen, aber nicht um den Erfolg in der Sache.2 Was zutrifft, kann hier offenbleiben.
Gegen den in unzähligen Meinungsumfragen ermittelten Willen der deutlichen Mehrheit der Bevölkerung trat die Bundesrepublik der NATO bei, und mit sehr dünner parlamentarischer Mehrheit wurden die Wehrgesetze verabschiedet. Konrad Adenauer war am Ziel: 1956 rückten die ersten Soldaten der neuen Bundeswehr in die Kasernen ein. Da sich Adenauer 1949 noch gegen die Errichtung einer neuen deutschen Wehrmacht ausgesprochen hatte, hießen die neuen Streitkräfte nicht mehr Wehrmacht, sondern Bundeswehr. Die Soldaten trugen nun amerikanische Stahlhelme, aber sie marschierten in denselben Knobelbechern wie die Soldaten der Wehrmacht. Um auch in solchen Details Unterschiede vorweisen zu können, hatten die neuen Stiefel an der äußeren Seite des Schafts eine kleine Lederschnalle aufgenäht bekommen, die aber keinerlei ergonomischen Sinn hatte. Die Soldaten bezeichneten sie deshalb scherzhaft als Demokratieschnalle.

Adenauer besucht am 20. Januar 1956 die neue Bundeswehr,
Foto: Rolf Unterberg, Bundesarchiv B 145 Bild-F003303-0016, CC-BY-SA-3.0.
Ernsthaftere Geister, die sich nicht mit gutmütigem Soldatenhumor damit abfinden konnten, wie die ersten 6 Jahre der neuen deutschen Demokratie abgelaufen waren, fragten sich, ob die Bundesrepublik nun tatsächlich eine Demokratie sei. Der angesehenste Philosoph der Bundesrepublik, Karl Jaspers, ging dieser Frage in seinem 1968 erschienenen Buch Wohin treibt die Bundesrepublik Deutschland? nach und fand, dass sie eigentlich keine Demokratie sei und die Parteien dem Grundgesetz eine sehr eigenwillige Deutungshoheit aufgezwungen hätten.15
Die Wiederbewaffnungsdebatte war der Geburtsfehler der Bundesrepublik und wurde zugleich zum Geburtsfehler der Bundeswehr: Sie wurde aufgestellt, obwohl eine deutliche Mehrheit sie nicht wollte, und logischerweise wurde sie damit zum ungeliebten Kind der deutschen Gesellschaft. Mehr noch: Die Mehrheit der Bevölkerung wollte einen neutralen gesamtdeutschen Staat, und nur Adenauer wollte die Westbindung der Bundesrepublik.
Quellen und weiterführende Hinweise (letzter Abruf 9. November 2024):
1 friedenskooperative.de/friedensforum/artikel/fuer-eine-bundesrepublik-ohne-armee-erfahrungen.
2 imi-online.de/download/Dez15_AN_Wiederbewaffnung.pdf.
3 Detlef Bald, Die Bundeswehr. Eine kritische Geschichte 1955-2005, 2005, Seite 21.
4 Lorenz Knorr, Geschichte der Friedensbewegung in der Bundesrepublik, 1983, Seite 36.
5 Norbert Tönnies, Der Weg zu den Waffen. Die Geschichte der deutschen Wiederbewaffnung 1949-1957, 1957, Seite 51.
6 de.wikipedia.org/wiki/Wiederbewaffnungsdiskussion#Entwicklung_der_Wiederbewaffnungsdebatte_bis_1950.
7 Norbert Tönnies, ebenda, Seite 53.
8 Lorenz Knorr, ebenda, Seite 35 f.
9 Lorenz Knorr, ebenda, Seite 41.
10 Eckart Dietzfelbinger, Die westdeutsche Friedensbewegung 1948-1955, Seite 105.
11 Fritz Krause, Antimilitaristische Opposition in der BRD 1949-55, 1971, Seite 103.
12 Helmut Kramer: Die justizielle Verfolgung der westdeutschen Friedensbewegung in der frühen Bundesrepublik
in: Detlef Bald/Wolfram Wette, Friedensinitiativen in der Frühzeit des Kalten Krieges 1945-1955, 2010, Seite 49.
13 Michael Werner, Zur Relevanz der „Ohne mich“-Bewegung in der Auseinandersetzung um den Wehrbeitrag, ebenda, Seite 84.
14 Kirkpatricks Memorandum vom 16. Dezember, ebenda, Seite 29.
15 Vollständiges Faksimile: bard.edu/library/pdfs/archives/2024/03/Jaspers-WohintreibtdieBundesrepublik.pdf.
Gesellschaftliche Integration
Was der Wiederbewaffnungsdebatte die eigentliche Schärfe verlieh, war die beabsichtigte Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht. Ohne mich! war der formelhafte Ausdruck für deren Ablehnung.
Himmeroder Denkschrift
Die Generale, die 1950 in der Abgeschiedenheit des Klosters Himmerod zusammenkamen, um für Bundeskanzler Adenauer eine Denkschrift zu verfassen, wie neue deutsche Streitkräfte aussehen könnten, wollten deshalb eine allgemeine Wehrpflicht umgehen und schlugen eine Art Freiwilligenarmee mit 250.000 Soldaten vor, was sie allerdings als Äußerstes des Möglichen bezeichneten. Um technische Belange, Nachschub und sonstigen Unterstützungsbedarf hätten sich nach ihren Vorstellungen überwiegend zivile Mitarbeiter kümmern sollen.1
Auf einen solchen Kompromiss hätte sich die Opposition möglicherweise eingelassen, denn damit wäre ihre Forderung Ohne Mich! ausreichend berücksichtigt gewesen. Auf der anderen Seite sah die Himmeroder Denkschrift von 1950 an Waffen bereits alles vor, was der Bundeswehr 1970 schließlich zur Verfügung stand.2 Auch die Einschätzung des gewinnbaren freiwilligen Personals erwies sich im Nachhinein als richtig (1970 gab es 233.000 Freiwillige in der Bundeswehr).3
Verworfen wurden diese Vorschläge aufgrund der Forderung der NATO, das deutsche Kontingent müsse 500.000 Soldaten betragen. Diese Zahl ließ sich freilich nur durch die Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht aufbringen.
Gesellschaftliche Integration
Die Politik behauptet seit 1956 unermüdlich, die Bundeswehr – gerade als Teil der NATO – sei ein anerkannter, fest integrierter Bestandteil der Gesellschaft. Dies ist eher Euphemismus. Diesen Selbstbetrug gab es auch schon 1970,4 und er gehört auch heute noch zu Sprachregelung der Politik.5 In sich widerspruchsfrei waren solche Darstellungen allerdings nie. So wurde 1970 die ablehnende Haltung der unruhigen Jugend beklagt,6 die den Dienstalltag als Gammeldienst empfinde.7 Sogar konservative Zeitungen wie die WELT sprechen heute offen von der Bundeswehr als ungeliebter Armee.8 Der Militärhistoriker Hagen Franke beschreibt ihre heutige Situation:9
In Studien des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam wird die Einstellung zur Bundeswehr durch die Bevölkerung mit 10 % sehr positiv, 36 % positiv und eher positiv mit 34 % dargestellt, jedoch bei der Frage, ob sie ihren Söhnen oder Töchtern empfehlen würden, die Bundeswehr als Arbeitgeber zu wählen, sind es um die 20 %, und ob sie Veranstaltungen der Bundeswehr besuchen, sind die Zahlen ähnlich (Forschungsbericht, Dez. 2018, S. 72 ff). Dagegen steht: Paraden und Waffenschauen der Bundeswehr sind fast nur noch hinter gesicherten Mauern möglich, Soldatinnen und Soldaten kommen morgens zum Dienstbeginn in Zivilkleidung und ziehen erst in der Kaserne ihre Uniform an, verschiedene Politiker und Vertreter von Lehrerverbänden wollen den Auftritt von Jugendoffizieren in Schulen abschaffen und als Gipfel der Entfremdung zur Bundeswehr ist ein Vorfall in einem Kindergarten zu sehen, in dem einem Kind eines Offiziers die Aufnahme dort verweigert wurde.
Das von Franke beschriebene Beispiel ist kein Einzelfall. Im Beitrag von Caroline Walter und Christoph Rosenthal zur ARD-Sendung Kontraste vom 15. Dezember 2015 kamen zahlreiche Soldaten zu Wort, die alle schilderten, wegen ihres an der Uniform erkennbaren Berufs in der Öffentlichkeit beleidigt, ausgesprochen schlecht behandelt und sogar angespuckt worden zu sein.10
Wehrdienstverweigerung
Als Gradmesser für die Qualität des Verhältnisses zwischen Bundeswehr und Gesellschaft kann bis zur Aussetzung der Wehrpflicht 2011 die Quote der Wehrdienstverweigerer an den gemusterten Wehrpflichtigen eines Jahrgangs gelten.
| Kalenderjahr11 | Verweigerungen | Einberufungen | Anteil (Prozent) |
| 1962 | 4.489 | 137.000 | 3,2 |
| 1968 | 11.952 | 175.000 | 6,4 |
| 1977 | 69.969 | 201.000 | 25,8 |
| 1989 | 77.400 | 173.000 | 30,9 |
| 1991 | 151.212 | 182.000 | 45,4 |
| 2002 | 189.644 | 122.000 | 60,6 |
Die Interpretation dieser Zahlen ist nicht schwierig: Während die ersten Jahrgänge der Einberufung noch widerwillig Folge leisteten, ermutigten die gesellschaftlichen Veränderungen ab 1968 einen immer größeren Teil der Wehrpflichtigen zur Verweigerung des Wehrdienstes, der als verlorene Lebenszeit bewertet wurde. Am Ende des Kalten Krieges verweigerte bereits ein knappes Drittel. Obwohl der Wehrdienst zwischen 1990 und 2002 von 15 Monaten nach und nach auf nur noch 6 Monate verkürzt wurde, verdoppelte sich der Anteil der Verweigerer auf fast zwei Drittel. Zusammenfällt dieser Anstieg mit den immer häufigeren Auslandseinsätzen der Bundeswehr, und man wird deshalb nicht falsch liegen, wenn die zunehmende Verweigerung als stummer Protest gegen die Auslandseinsätze aufgefasst wird.
Ohne die Mitgliedschaft in der NATO und deren Vorgabe an die Bundesrepublik, 500.000 Soldaten zu stellen, wäre die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht nicht erforderlich gewesen, und damit wäre auch ein erheblicher Glaubwürdigkeitsverlust des neuen demokratischen Staates verhindert worden, der zugleich die gesellschaftliche Integration der Bundeswehr konterkarierte. Dieser Makel haftet der Bundeswehr bis heute an.
Die Bundeswehr ist heute für 185.000 freiwillige Soldaten ausgelegt. Diese Soll-Stärke erreicht sie nur knapp. Die Idee, zur Abdeckung des Personalbedarfs auf die allgemeine Wehrpflicht zurückzugreifen,12 ignoriert, dass 61 Prozent der Wehrpflichtigen dies nicht wollen, was 2011 auch zur Aussetzung der Wehrpflicht geführt hatte. Ignoriert wird zugleich, dass 1970 in der alten Bundesrepublik mit damals 60 Millionen Einwohnern noch 233.000 Freiwillige geworben werden konnten, während es heute bei 84 Millionen Einwohnern nur 183.000 sind. Grund sind offensichtlich die Auslandseinsätze, die auf Ablehnung stoßen. Würde der Auftrag der Bundeswehr wieder allein auf die Landesverteidigung reduziert, werden sich wahrscheinlich auch wieder deutlich mehr Freiwillige gewinnen lassen.
Quellen und weiterführende Hinweise (letzter Abruf 10. November 2024):
1 Faksimile der Himmeroder Denkschrift online auf
bundeswehr.de/resource/blob/5216326/77501d50befc687d9502723b2060a2b0/himmeroder-denkschrift-data.pdf,
gut zusammengefasst auf de.wikipedia.org/wiki/Himmeroder_Denkschrift#Inhalt_der_Denkschrift.
2 Zum Vergleich des Zustands 1970 mit den Vorgaben der Himmeroder Denkschrift:
Emil Obermann, Gesellschaft und Verteidigung, 1970, Seite 765.
3 Emil Obermann, ebenda, Seiten 720 und 722.
4 Emil Obermann, ebenda, Seiten 674 ff.
5 bmvg.de/de/aktuelles/bevoelkerungsumfrage-2020-so-steht-deutschland-zur-bundeswehr-5029586.
6 Emil Obermann, ebenda, Seite 671.
7 Emil Obermann, ebenda, Seite 679.
8 welt.de/politik/ausland/article117156165/Die-Bundeswehr-Deutschlands-ungeliebte-Armee.html.
9 Sorgenkind Bundeswehr-Versuch einer Analyse, auszugsweise wiedergegeben, vollständig als PDF auf kompetenz-geschichte.de.
10 rbb-online.de/kontraste/ueber_den_tag_hinaus/bundeswehr/gegen-bundeswehr-oeffentliche-anfeindungen-und-missachtungen.
11 de.wikipedia.org/wiki/Kriegsdienstverweigerung_in_Deutschland.
12 esut.de/2024/10/fachbeitraege/52605/wiedereinfuehrung-der-wehrpflicht-in-deutschland-eine-debatte-zwischen-tradition-und-modernitaet.
Innere Führung
Adenauer wusste natürlich, dass sein Versprechen, mit ihm würde es keine neue Wehrmacht geben, wörtlich und damit so aufgefasst würde, dass sich die neue Bundesrepublik keine Streitkräfte zulegen würde, zumindest keine Wehrpflichtarmee. Deshalb mussten sich die Generale im Kloster Himmerod zugleich einiges einfallen lassen, um die neue Bundeswehr deutlich von der alten Wehrmacht unterscheidbar zu machen. Amerikanisch inspirierte Uniformen und andere Äußerlichkeiten genügten dazu nicht. Es bedurfte eines neuen Selbstverständnisses, einer neuen Führungskultur und – alles in allem – eines neuen Geistes. Zusammengefasst wurden dies unter dem Begriff Innere Führung. Einfach umzusetzen war dies nicht, denn bei der Ausbildung der neuen Bundeswehr war man auf ehemalige Offiziere und Unteroffiziere angewiesen, die noch vom Geist der Wehrmacht geprägt waren.
Definition Innere Führung
Es wurde immer wieder versucht, den Begriff Innere Führung formelmäßig zu definieren. Der erste Definitionsversuch wurde 1964 unternommen und lautete: Innere Führung ist die Summe aller Führungsmaßnahmen, die die Geistes- und Willenskräfte des Soldaten für die Erfüllung seines Auftrags wirksam machen. Innere Führung ist die Aufgabe aller Vorgesetzten, Staatsbürger zu Soldaten zu erziehen, die fähig und willens sind, Recht und Freiheit des deutschen Volkes und seiner Verbündeten in der geistigen Auseinandersetzung zu wahren und zu fördern und im Kampfe mit der Waffe tapfer zu verteidigen. Dieses Ziel wird erreicht durch zeitgemäße Menschenführung und geistige Rüstung innerhalb unserer Lebensordnung und soldatischen Ordnung. Innere Führung geht hierbei aus von den politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten, bekennt sich zu unserem Grundgesetz, macht soldatische Tugenden lebendig und übernimmt bewährte Erfahrungen in unsere heutigen Lebensformen und berücksichtigt die Folgen der Anwendung und Wirkung moderner technischer Mittel.1
Inhalt
Die Definition klingt bemüht, ist aber schwer verständlich und verdient daher eine ungefähre Übersetzung: Nach den Grundsätzen der Inneren Führung
- nehmen sich Soldaten nicht als Untertanen, sondern als Staatsbürger in Uniform wahr, deren staatsbürgerliche Rechte durch den Militärdienst nicht eingeschränkt oder gar aufgehoben werden. Soldaten nehmen selbstverständlich an der öffentlichen Debatte zu allen gesellschaftlichen und politischen Fragen teil. Sie können sich auf das grundgesetzlich zugesicherte Koalitionsrecht berufen, Vertrauensleute wählen und Interessenvertreter bestimmen. Die Unantastbarkeit der Menschenwürde schützt sie vor schikanösen Befehlen und erniedrigenden Ausbildungsmethoden.
- sind die Streitkräfte fest in Staat und Gesellschaft integriert. Sie sind kein Staat im Staat, wie es in der Weimarer Republik die Reichswehr war. Sie unterliegen stets dem Primat der Politik, die von Regierung und Parlament gestaltet wird. Wesentliche staatliche und gesellschaftliche Werte werden auch in den Streitkräften beachtet und verwirklicht.
- bedürfen Streitkräfte einer ethischen, rechtlichen und politischen Legitimation ihres Auftrages, wodurch dem militärischen Subordinationsprinzip von Befehl und Gehorsam Grenzen gesetzt werden. Rechtlich unvertretbare Befehle müssen hinterfragt und dürfen nicht in bedingungslosem Gehorsam ausgeführt werden. Dadurch entsteht für jeden Soldaten eine eigene Verantwortung für sein Handeln. Auf einen Befehlsnotstand kann er sich nicht berufen.
- eröffnet das Prinzip des Führens mit Auftrag dem Soldaten ein eigenes Ermessen und erlegt ihm zugleich eigene Verantwortung für rechtskonformes Handeln auf: Im Rahmen seines Entscheidungsrahmens ist er gehalten, die rechtskonforme Handlungsalternative zu wählen.2
Die vorstehend umrissenen Grundsätze der Inneren Führung sind in einer Dienstvorschrift niederlegt.3
Praktische Bewährung
Wehrpflichtige vermochte die Innere Führung dennoch nicht vom Dienst in der Bundeswehr als guter Sache zu überzeugen. Die angestrebte Integration der Bundeswehr in die deutsche Gesellschaft muss ebenfalls als misslungen bezeichnet werden, wenn sich Soldaten ungern in Uniform auf der Straße zeigen und öffentliche Auftritte der Bundeswehr in Pfeifkonzerten enden. Die ethische Bewährungsprobe stellte sich der Inneren Führung erst mit den Auslandseinsätzen. Bekannt wurden zwei Fälle:
Der Fall Christiane Ernst-Zettl
Die Sanitätssoldatin Christiane Ernst-Zettl kam 2005 nach Afghanistan. Dort sollte sie nach Anweisung ihres Vorgesetzten ihr Rotes-Kreuz-Schutzzeichen ablegen und vor dem Lager Camp Warehouse Personenkontrollen durchführen. Sie verwies auf das Kriegsvölkerrecht, das es verbietet, Sanitäter, da diese nicht zu den Kombattanten zählen, für militärisch-operative Aufgaben heranzuziehen. Für diese Weigerung wurde gegen sie eine Disziplinarmaßnahme in Form einer Geldbuße von 800 Euro verhängt. Die juristische Aufarbeitung verlief unglücklich und ist nicht eindeutig nachvollziehbar: Das Bundesverwaltungsgericht bejahte angeblich, dass der Befehl gegen das Völkerrecht verstoßen hätte, hielt jedoch den Antrag der Soldatin für unzulässig: Das Wehrbeschwerdeverfahren diene nicht dazu, das Handeln oder die Anordnung bzw. Erlasse von Vorgesetzten oder Dienststellen der Bundeswehr im Allgemeinen zu überprüfen.4 In diesem Fall hatte sich die Soldatin zwar entsprechend den Grundsätzen der Inneren Führung verhalten, dennoch wurde sie disziplinarrechtlich belangt.
Der Fall Florian Pfaff
Ähnlich erging es dem Major Florian Pfaff: Er verweigerte 2003 die Mitarbeit im Bundeswehr-Softwareprojekt SASPF, weil er sie für eine indirekte Unterstützung des nach seiner Auffassung völkerrechtswidrigen Krieges gegen den Irak hielt. Noch am gleichen Tag wurde gegen ihn eine psychiatrische Untersuchung angeordnet, die eine Woche dauerte, aber keinen Hinweis auf eine geistig-seelische Störung ergab. Daraufhin wurde ihm befohlen, sich nicht mehr mit der Frage zu befassen, ob er an Verbrechen mitwirke oder nicht. Diesem Befehl widersetzte er sich. Der Versuch, Pfaff fristlos zu entlassen, scheiterte zwar, doch das Truppendienstgericht Nord degradierte ihn, und die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen ihn wegen Gehorsamsverweigerung und Ungehorsams. 2005 hob das Bundesverwaltungsgericht die Entscheidung des Truppendienstgerichts auf.5 Die Staatsanwaltschaft stellte das Ermittlungsverfahren ein. Dennoch versagte das Personalamt Pfaff später die ihm vom Dienstalter her zustehende Beförderung zum Oberstleutnant: Es bestünden begründete Zweifel an seiner uneingeschränkten persönlichen Eignung und Befähigung, diesem Dienstgrad gerecht zu werden. Dabei hatte ihn sein Vorgesetzter nur Tage zuvor positiv beurteilt und die Beförderung ausdrücklich befürwortet.6
Ein Offizier kommentierte:7 Soll wohl heißen: Ein Soldat, der sich weigert, an einem Bruch der Verfassung mitzuwirken, ist in der Bundeswehr eigentlich völlig fehl am Platze. Die auf potenzielle Nachahmer Pfaffs abzielende Botschaft ist eindeutig: Wer nicht pariert, wird sanktioniert. Mag einer auch vor höchsten Gerichten noch so viel Recht haben und bekommen – es gilt die Parole „EdeKa“, gleichbedeutend mit: Ende der Karriere!
Institutionalisierung
Solche Vorfälle lassen den Eindruck aufkommen, dass die Innere Führung womöglich nur ethische Kosmetik ist. Dennoch wird um die Innere Führung geradezu ein Kult betrieben: Seit der Aufstellung der Bundeswehr gibt es in Koblenz das Zentrum Innere Führung, eine Einrichtung, die von einem Generalmajor und einem Brigadegeneral geleitet wird und rund 250 militärische und zivile Dienstposten umfasst; die Organisation wird auf seinem Wikipedia-Eintrag gut beschrieben.8 Der Auftrag wird von der Bundeswehr selbst so formuliert: Das Zentrum Innere Führung setzt sich als national anerkannte und international vernetzte Ausbildungseinrichtung mit Leitfunktion für die Weiterentwicklung, Gestaltung und Vermittlung der Inneren Führung ein. Seine Expertise, seine Kompetenzen und sein Leistungsangebot bilden den Rahmen für Bildung und Zertifizierung aller Ausbildungseinrichtungen der Bundeswehr in allen Fragen und Handlungsfeldern der werteorientierten Führungs- und Organisationskultur. Gleichzeitig ist das Zentrum Innere Führung die zentrale Bildungsinstitution zur Weiterentwicklung individueller Führungskompetenzen.9
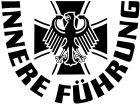
Daneben besteht seit 1958 beim Verteidigungsministerium noch der Beirat für Fragen der Inneren Führung, der sich aus Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zusammensetzt, vor allem aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Erziehungswesen sowie der Kirchen, Gewerkschaften, Verbände und Medien. Damit soll er ein Spiegelbild der bedeutenden gesellschaftlichen Kräfte in der Bundesrepublik Deutschland sein und den Verteidigungsminister beraten.
Die bemerkenswert groß angelegte Organisation um die Führungskultur drückt einen Eifer aus, der die Hypothese zulässt, dass er nur zur Schau getragen, aber nicht ernst gemeint ist.
Armee ohne Tradition
Bei diesen Bemühungen – auf Kosten der Steuerzahler – geht es im Grunde immer noch um die Beweisführung, dass der erste Bundeskanzler Adenauer sein Wahlversprechen nicht gebrochen hätte und die Bundeswehr keine neue Wehrmacht sei. Ergänzt wird dies um den sogenannten Traditionserlass, nach dem lediglich die militärischen Widerstandskämpfer gegen Hitler als soldatisches Vorbild geeignet seien, die Wehrmacht jedenfalls nicht. Auch die Reichswehr der Weimarer Republik wird als traditionsstiftendes Vorbild abgelehnt, sei sie ein Staat im Staate gewesen, und die Armee der Kaiserzeit hätte die Gesellschaft in verhängnisvoller Weise militaristisch geprägt. Deshalb durfte und darf in der Bundeswehr nichts so sein wie bei ihren Vorgängerinnen.11

Bundeswehr Wachbataillon, Foto gemeinfrei
Durchhalten lässt sich dies natürlich nicht. Konsequenter Weise dürfte es bei der Bundeswehr nicht einmal eine Militärmusik geben, schon gar keine, die dasselbe Repertoire aufführt wie die Musikkorps der Wehrmacht. Es dürfte auch kein Wachbataillon geben, und schon gar nicht dürfte das Wachbataillon bewusst alte Gewehre der Wehrmacht verwenden, weil sich die Präsentiergriffe der Wehrmacht an modernen Sturmgewehren nicht ohne weiteres ausführen lassen.
Übersehen wird dabei, dass andere Staaten wie Frankreich, Großbritannien oder Italien bei der Anwerbung von Freiwilligen bewusst auf die oft jahrhundertealten Traditionen ihrer militärischen Verbände setzen, und dies mit einigem Erfolg. Mit ihrer kontinuierlichen moralischen Empörung über sich selbst steht sich die Bundeswehr daher selbst im Wege, vor allem, wenn es um die Werbung von Personal geht. Dabei ist ihre heutige Form einer Freiwilligenarmee sicher das beste Mittel, eine Militarisierung der Gesellschaft zu verhindern.
Diverse Bundeswehr
Seit 2015 ist die Bundeswehr vielfältig geworden, und Diversität ist wurde zum unbedingten Bestandteil ihrer Führungs- und Organisationskultur. Am 28. Mai jeden Jahres wird der Diversity-Tag begangen, und das Referat P III 4 – Chancengerechtigkeit und Vielfalt im Geschäftsbereich BMVg – koordiniert auf der strategischen Ebene Projekte und Maßnahmen zum Vielfaltsmanagement in der Bundeswehr.12
Seitdem achtet man auf Barrierefreiheit,13 hat homosexuelle Soldaten rehabilitiert14 und achtet bei jedem Foto darauf, dass gleich viele Frauen und Männer oder Frauen in Führungsrollen darauf zu sehen sind. Wer sich unsicher ist, wie man damit umgeht, besucht Lehrveranstaltungen im Zentrum Innere Führung.

Foto: Bernd von Jutrczenka, picture alliance/dpa15
Quellen und weiterführende Hinweise (letzter Abruf 27. November 2024):
1 Emil Obermann, Gesellschaft und Verteidigung, 1970, Seite 650.
2 nach Emil Obermann, ebenda, Seiten 650 bis 668.
3 bundeswehr.de/resource/blob/5361386/61cca4d2451734a38f93ce8ab1cdb5de/00-vorschrift-innere-fuehrung-data.pdf.
4 BVerwG 1 WB 58.06 und 1 WB 64.06
5 BVerwG 2 WD 12.04
6 de.wikipedia.org/wiki/Florian_Pfaff.
7 bits.de/public/gast/rose-freitag3.htm.
8 de.wikipedia.org/wiki/Zentrum_Innere_Führung.
9 bundeswehr.de/de/organisation/weitere-bmvg-dienststellen/zentrum-innere-fuehrung.
10 de.wikipedia.org/wiki/Beirat_Innere_Führung.
11 bmvg.de/resource/blob/23234/6a93123be919584d48e16c45a5d52c10/20180328-die-tradition-der-bundeswehr-data.pdf.
12 bundeswehr.de/de/ueber-die-bundeswehr/selbstverstaendnis-bundeswehr/chancengerechtigkeit-bundeswehr/vielfalt-bundeswehr,
zugleich Quellenangabe zu den nachfolgenden Fotos.
13 bundeswehr.de/de/aktuelles/schwerpunkte/inklusion-bundeswehr-steht-fuer-barrierefreiheit.
14 bundeswehr.de/de/ueber-die-bundeswehr/selbstverstaendnis-bundeswehr/chancengerechtigkeit-bundeswehr/rehabilitierung-homosexueller-soldatinnen-soldaten.
15 Sekundärquelle: table.media/security/news/diversitaet-bei-der-bundeswehr-das-steht-in-der-neuen-strategie-des-verteidigungsministeriums.
Skandalisierung der Bundeswehr
Das Klientel von CDU und CSU sah Adenauers Methoden, die Wiederbewaffnung durchzusetzen, wesentlich gelassener als das linke Spektrum der Gesellschaft, zu dem sich der überwiegende Teil der Journalisten zählte (und auch heute noch zählt).1 Die Medien beobachteten die Entwicklung der Bundeswehr daher akribisch und ließen keine Gelegenheit aus, sie zu skandalisieren. Dies trug für sich genommen nicht dazu bei, die gesellschaftliche Akzeptanz der Bundeswehr zu verbessern.
Spiegel-Affäre
Die ewige Kontroverse zwischen Presse und Bundeswehr nahm mit der Spiegel-Affäre 1962 ihren Anfang, bei der Franz Joseph Strauß als Verteidigungsminister für den eigentlichen Skandal sorgte.
In der Spiegel-Ausgabe vom 10. Oktober 1962 erschien unter dem Titel Bedingt abwehrbereit ein Artikel, wonach das NATO-Oberkommando bei seiner Auswertung des Manövers FALLEX62 zu der Beurteilung gelangt sei, die Bundeswehr sei aufgrund ihrer mangelhaften Ausstattung zur Vorwärtsverteidigung ungeeignet. Dies war mit erheblicher Kritik an Strauß verbunden. Noch am Tag des Erscheinens nahm der Generalbundesanwalt einen Fall von Landesverrat an. Am 23. Oktober 1962 wurden Haftbefehle gegen die Verfasser sowie den Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein erlassen, und die Redaktionsräume wurden über einen Monat lang durchsucht.2 Dies führte zu Protesten, da das Vorgehen der Polizei als Angriff auf die Pressefreiheit angesehen wurde. Im November 1962 stellte sich heraus, dass Strauß bereits vor Erscheinen des Artikels über dessen Inhalt und Quellen informiert gewesen sei und die Strafverfolgung selbst initiiert habe. Am 30. November erklärte Strauß seinen Rücktritt. Augstein und die Redakteure wurden aus der Untersuchungshaft entlassen, und am 13. Mai 1965 meinte der Bundesgerichtshof, dass es keine Beweise für einen Verrat von Staatsgeheimnissen gäbe. Das Verfahren wurde eingestellt.3
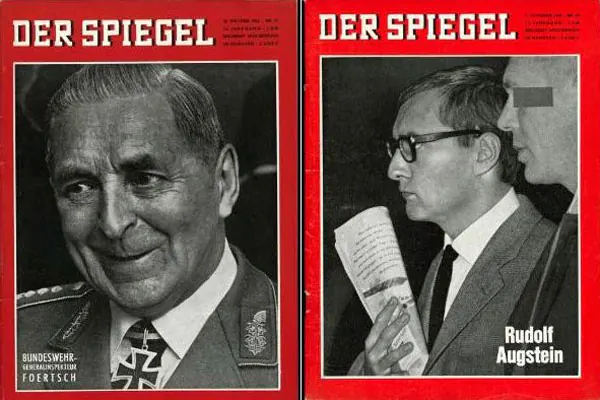
Die maßgeblichen Ausgaben des SPIEGEL,
Urheber und Copyright: DER SPIEGEL
Tiefste Gangart
Dass vor allem Der Spiegel die Bundeswehr anschließend besonders scharf beobachtete und bei jeder Gelegenheit kritisierte, ist nicht verwunderlich. Schon ein Jahr nach der Spiegel-Affäre, 1963, fand er heraus, dass am Standort Nagold ein Rekrut an den Strapazen der militärischen Ausbildung gestorben war, und es kamen die entwürdigenden Drill-Methoden der Schleifer von Nagold heraus. Der Titel der Geschichte lautete Tiefste Gangart, und mehrerer Offiziere und Ausbilder wurden verurteilt.4 Kritiker sahen sich bestätigt, es habe sich im Vergleich zur Wehrmacht nicht das Geringste verändert, und das stets beteuerte neue Menschenbild vom Staatsbürger in Uniform sei pure Heuchelei.
HS-30-Affäre
Gleich 1956 suchte die Bundeswehr nach einem geeigneten Schützenpanzer. Das einzige Modell, das den Vorgaben entsprach, aber nur in Planzeichnungen existierte, war der HS-30 des Schweizer Hispano-Suiza-Konzerns, der sich bis dahin als Hersteller eleganter Sportwagen empfohlen hatte, jedoch noch nie als Hersteller von Militärfahrzeugen. Dem Verteidigungsausschuss des Bundestages konnte deshalb nur ein aus Holz und Pappe angefertigtes Modell vorgeführt werden. Der Abgeordnete Helmut Schmidt (SPD) schlug vor, erst einige Prototypen bauen zu lassen, um den HS-30 gründlich zu testen, doch wurde dieser Einwand wurde von CDU/CSU überstimmt.5 Als die Auslieferung 1959 begann, erwies sich der HS-30 als untauglich, viel zu schwach motorisiert, und bei einer Panne hätte ein liegengebliebenes Fahrzeug sofort gesprengt werden müssen.
Journalisten fanden heraus, dass die Bestellung des HS-30 mit Schmiergeldzahlungen eingefädelt worden war.6 1967 setzte der Bundestag einen Untersuchungsausschuss ein, der 1969 seinen Bericht vorlegte: Der persönliche Referent des damaligen Verteidigungsministers Franz Josef Strauß Werner Repenning soll 2,3 Millionen DM erhalten haben, der CDU-Politiker Otto Lenz und der Waffenhändler Otto Praun jeweils 300.000 DM. Praun wurde 1960 ermordet. Dafür wurde 1962 Prauns Erbin Vera Brühne zu lebenslanger Haft verurteilt, obwohl an ihrer Täterschaft erhebliche Zweifel bestanden. Lenz starb, bevor er vor dem Untersuchungsausschuss aussagen konnte, in Neapel.5
Der als Zeuge vernommene CDU-Politiker Werner Plappert sagte aus, die CDU habe im Zusammenhang mit der Bestellung des HS-30 50 Millionen DM für ihren Bundestagswahlkampf 1957 erhalten: Auf deutscher Seite war das Panzergeschäft nur ein Mittel zur illegalen Parteienfinanzierung. Was dann geliefert wurde, war sekundär.5 Plappert wurde 1974 tot aus dem Bodensee geborgen7. Nachdem Franz Josef Strauß 1978 bayerischer Ministerpräsident geworden war, begnadigte er 1979 Vera Brühne.8 Obwohl Zusammenhänge plausibel erscheinen, gilt nichts als eindeutig bewiesen.
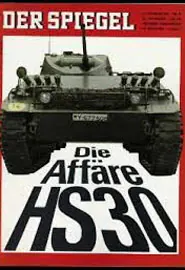
Urheber und Copyright: DER SPIEGEL
Lockheed-Affäre
Etwa gleichzeitig mit dem Kauf des HS 30 suchte die Bundeswehr ein Kampfflugzeug. Zur Auswahl standen die französische MIRAGE und die amerikanische F-104 STARFIGHTER des Herstellers Lockheed. Gegen den Rat von Experten entschied sich Verteidigungsminister Franz Josef Strauß sehr schnell für den STARFIGHTER. Anfang 1958 stimmte der Verteidigungsausschuss zu. Von 750 ausgelieferten Maschinen stürzten nach und nach etwa 250 ab, über ein Drittel.
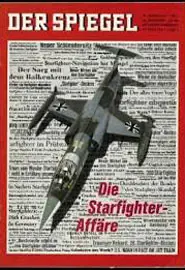
Urheber und Copyright: DER SPIEGEL
Bekannt wurde, dass Lockheed in Italien, den Niederlanden und Japan Politiker bestochen hatte, um dort den Ankauf des STARFIGHTER durchzusetzen. Ein solcher Verdacht kam deshalb auch in der Bundesrepublik auf.9,10 Nach Aussage eines ehemaligen Lockheed-Mitarbeiters sollen Strauß und die CSU 1961 10 Millionen Dollar für die deutsche Bestellung des STARFIGHTER erhalten haben. Eindeutige Beweise gegen Strauß ergaben sich nicht. Dennoch flammte das Thema vor der Bundestagswahl 1976 neuerlich auf. Diesmal wurde der CDU-Politiker Manfred Wörner belastet, der später Verteidigungsminister wurde. Amerikanische Untersuchungen ergaben, dass Lockheed etwa 1,2 Millionen DM Bestechungsgeld gezahlt hätte, davon eine beträchtliche Summe an einen Abteilungsleiter im Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung.9
Kießling-Affäre
Neben diesen großen Skandalen gab es auch kleinere Verfehlungen einzelner Soldaten.11 Politische Auswirkungen hatten lediglich der Abhör-Skandal des MAD, der 1978 zum Rücktritt des Verteidigungsministers Georg Leber führte,12 sowie die voreilige Entlassung des der Homosexualität verdächtigten Generals Kießling durch den Verteidigungsminister Wörner 1983.13 Das Unangenehme an dieser Affäre war, dass General Kießling das Opfer einer Intrige wurde, die spiegelbildlich ablief wie die von Hitler und Göring 1938 gegen den Oberbefehlshaber des Heeres von Fritsch initiierte Intrige.14
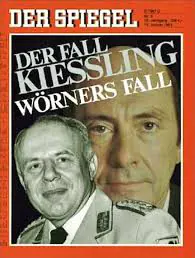
Urheber und Copyright: DER SPIEGEL
Ab 2012: Selbstskandalisierung
Ab 2012 folgte ein Skandal auf den anderen, wie schlecht es um die Ausrüstung der Bundeswehr bestellt sei. Diese Skandale unterscheiden sich von ihren Vorgängern dadurch, dass nicht Journalisten die Verhältnisse aufdeckten, sondern das Verteidigungsministerium selbst. Damit sollte der Öffentlichkeit ein schockierendes Bild von einem völlig desolaten Zustand der Bundeswehr vermittelt werden, um Verständnis für eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben zu erreichen. Dabei wird durchaus manipulativ vorgegangen, wie die Affäre um den Rüstungshersteller Heckler & Koch nahelegt:
Heckler & Koch-Skandal
1995 wurde das Sturmgewehr G36 bestellt. Vertragspartner war Heckler & Koch. Die Auslieferung erfolgte 1997.15 Nach 15 Jahren beanstandungsfreien Gebrauchs berichtete – natürlich – Der Spiegel im April 2012,16 die Bundeswehr habe bei Versuchen festgestellt, das G36 würde nach mehreren hundert Schuss so heiß, dass die Trefferwahrscheinlichkeit auf Entfernungen über 300 Meter erheblich sinke.17 In ein Magazin dieser Waffe passen allerdings nur 30 Patronen, sodass sich fragt, wie mehrere hundert Schuss hintereinander unter realistischen Bedingungen überhaupt abgegeben werden können. Die Truppe war dagegen mit der Waffe zufrieden und hatte bei Schießübungen noch nie Fehlleistungen festgestellt.18
Dennoch griffen alle Medien den Skandal gerne auf. Das Ministerium bezeichnete sich als betrogen und ging auch strafrechtlich gegen den Hersteller Heckler & Koch vor, obwohl rechtlich 15 Jahre nach Auslieferung eher an Verjährung statt an Betrug zu denken war.19 Auch sonst sah sich das Unternehmen einer politischen und medialen Kampagne ausgesetzt, als ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender 2015 den Spielfilm Meister des Todes ausstrahlte, der wenig verstellt auf Heckler & Koch anspielte.20 Heckler & Koch ging umgekehrt gerichtlich gegen die Behauptungen des Ministeriums vor und bekam 2016 Recht: Nach einer Beweisaufnahme wurde im Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz festgestellt, das G36 sei mangelfrei und genau so beschaffen, wie es nach der Bestellung zu sein hatte. Damit wurde das gleichlautende Urteil der Eingangsinstanz bestätigt.21
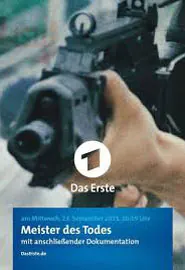
Urheber und Copyright: ARD
In die Welt gesetzt hatte die negativen Behauptungen über das G36 eine technische Dienststelle der Bundeswehrverwaltung, die das Gewehr unter bemerkenswerten Extrembedingungen getestet hatte. Das Testergebnis wurde den Medien mutmaßlich zugespielt, die einen Skandal daraus machten. Über den Prozesserfolg von Heckler & Koch wurde spärlich berichtet. Haften blieb im Gedächtnis der Öffentlichkeit ein Rüstungsskandal sowie Empörung, wie schlecht es um die Ausrüstung der Bundeswehr bestellt sei.
Haltungsmängel
Im Januar 2017 wurde von Medien mitgeteilt, in der Staufer-Kaserne in Pfullendorf würden Aufnahmerituale mit sexuell entwürdigenden Bezügen praktiziert, welche die damals amtierende Verteidigungsministerin von der Leyen spontan als abstoßend und widerwärtig bezeichnete und die Soldaten entließ.22 Die Staatsanwaltschaft Hechingen nahm Ermittlungen auf und stellte das Ermittlungsverfahren alsbald mit der Begründung ein, es gäbe nicht einmal einen hinreichenden Anfangsverdacht für Straftaten.23 In etlichen Medien wurde vermutet, dass das Verteidigungsministerium vor allem gegenüber den Fachpolitikern des Bundestags die Sachlage bewusst übertrieben dargestellt hätte: Von der Leyen hat also den Missstand zunächst drastisch beschrieben, um dann als Aufklärerin zu glänzen – eine bevorzugte Rolle der Ministerin.24
Gleich im April 2017 wurde aus dem Standort Sondershausen bekannt, dass ein Ausbilder einen Rekruten als Abschaum bezeichnet und überhaupt äußerst strapaziöse Laufübungen angeordnet hätte. Daraufhin wurde der Kommandeur des Ausbildungskommandos des Heeres augenblicklich in den Ruhestand versetzt.25 Bemerkenswert war, dass Der Spiegel über diese Personalentscheidung bereits berichtet hatte, bevor dem Betroffenen selbst die Entlassung mitgeteilt wurde.26 Ein anderer General kommentierte: So geht man mit keinem Menschen um. Da wurde publikumswirksam ein Zwei-Sterne-General an den Pranger gestellt. Er ist einer der geradlinigsten und integersten Offiziere, die ich kenne. Mit dieser Absetzung wolle von der Leyen nur von anderen Problemen in der Bundeswehr ablenken, meinte er.27
Dazwischen gab es noch im Februar 2017 den Fall des Oberleutnants Franko A.28 Er enthält zu viele Merkwürdigkeiten, um ihn hier knapp dazustellen. Nach Auffassung der Ministerin von der Leyen zeigten alle diese Fälle, die sich bemerkenswert zufällig in einem sehr kurzen Zeitraum von knapp vier Monaten zugetragen hatten, dass die Bundeswehr ein generelles Haltungsproblem habe. Missstände würden aus falsch verstandenem Korpsgeist schöngeredet … Es wird weggeschaut. Das gärt dann, bis es zum Eklat kommt. Und das ist nicht in Ordnung.29

Ursula von der Leyen 2014, Foto: Dirk Vorderstraße – CC BY 3.0, commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34048622
Am 7. Mai 2017 ordnete die Ministerin an, alle Bundeswehrgebäude nach Wehrmachtsandenken zu durchsuchen. Nach Angaben von der Leyens fand man bei der Durchsuchung bis zum 12. Mai 2017 einundvierzig Wehrmachtsandenken, darunter ein Foto des früheren Bundeskanzlers Schmidt in Wehrmachtsuniform, eine Rotkreuzflagge des Zweiten Weltkriegs sowie Bilder von Wehrmachtssoldaten, die Großväter heutiger Soldaten waren. Sinn und Verhältnismäßigkeit des von der Leyen selbst sogenannten Säuberungsprozesses blieben unklar.30
Fazit
Hier sind nur die bekanntesten Skandale aufgezählt. Es ging um Schmiergeld, Intrigen und künstlich inszenierte Geschichten zur Einflussnahme auf die öffentliche Meinung. In Ordnung waren die Dinge, wie die Beispiele zeigen, bei der Bundeswehr nie. Bemerkenswert ist jedoch eine Trendwende:
Von der Presse skandalisiert wurde die Bundeswehr bis 2011. Mit der Aussetzung der Wehrpflicht verging ihr diese Lust. Daran zeigt sich, dass ihre rigorose Ablehnung ausschließlich an der Wehrpflicht lag. Ab 2012 skandalisierte sich die Bundeswehr selbst, erst um an mehr Geld aus dem Bundeshaushalt zu kommen, später dann – mutmaßlich – um wokes Bewusstsein zu etablieren und vorsorglich Kräfte auszuschalten, die sich womöglich dagegen ausgesprochen hätten.
Quellen und weiterführende Hinweise (letzter Abruf 12. November 2024):
1 Michael Rasch, Das Herz des deutschen Journalisten schlägt links am 8. November 2018 in: Neue Züricher Zeitung
(online: nzz.ch/international/das-herz-des-deutschen-journalisten-schlaegt-links-ld.1434890).
2 de.wikipedia.org/wiki/Spiegel-Affäre.
3 spiegel.de/politik/dokumentation-die-kosten-traegt-die-bundeskasse-a-429ae890-0002-0001-0000-000046272783?context=issue.
4 Artikel Tiefste Gangart in: DER SPIEGEL Heft 46/1063
(online: spiegel.de/politik/tiefste-gangart-a-bef3124f-0002-0001-0000-000046172730).
5 de.wikipedia.org/wiki/HS-30-Skandal.
6 Rudolf Augstein, HS 30 – oder Wie man einen Staat ruiniert am 23. Oktober 1966 in: DER SPIEGEL
(online: spiegel.de/politik/hs-30-oder-wie-man-einen-staat-ruiniert-a-a93a7879-0002-0001-0000-000046414788).
7 de.wikipedia.org/wiki/Werner_Plappert#Verschwinden_und_Tod.
8 de.wikipedia.org/wiki/Vera_Brühne,
welt.de/geschichte/kopf-des-tages/article235638198/Vera-Bruehne-Schon-vor-dem-Urteil-war-sie-Moerderin-und-gieriges-Luder.html,
deutschlandfunk.de/die-zu-lebenslanger-haft-verurteilte-vera-bruehne-wird-100.html.
9 de.wikipedia.org/wiki/Lockheed-Skandal#Deutschland,
de.wikipedia.org/wiki/Starfighter-Affäre.
10 spiegel.de/politik/ein-gewisses-flattern-a-4aae3cdd-0002-0001-0000-000038223909?context=issue.
11 2006 Totenkopf-Affäre: spiegel.de/politik/deutschland/totenkopf-affaere-mitwisser-bringen-regierung-in-erklaerungsnot-a-448116.html.
2010 Saufrituale: taz.de/Aufnahme-Rituale-bei-Bundeswehr/!5147123.
12 de.wikipedia.org/wiki/Georg_Leber#Bundesverteidigungsminister.
13 de.wikipedia.org/wiki/Kießling-Affäre.
14 de.wikipedia.org/wiki/Blomberg-Fritsch-Krise.
15 de.wikipedia.org/wiki/HK_G36.
16 Heft 14/2012, Seite 15.
17 spiegel.de/politik/gewehr-mit-schwaechen-a-84f32fbf-0002-0001-0000-000084631730?context=issue.
18 Stellungnahme des Herstellers vom 3. April 2012, nur noch auf web.archive.org/web/20120717010519/http://www.heckler-koch.com/de/militaer/unternehmen/news/detail/article/communique-current-media-reports-regarding-the-g36-assault-rifle.html.
19 rechtslupe.de/strafrecht/betrug-und-seine-verjaehrung-3103591.
20 daserste.de/unterhaltung/film/themenabend-waffenexporte/doku/index.html.
21 n-tv.de/wirtschaft/Heckler-Koch-klagt-in-G36-Skandal-article15441826.html,
faz.net/aktuell/politik/inland/bundeswehr-verliert-sturmgewehr-g36-prozess-gegen-heckler-koch-14417235.html,
taz.de/Prozess-Heckler–Koch-in-Koblenz/!5306863.
22 taz.de/Bundeswehr-Gewaltskandal-in-Pfullendorf/!5378717.
spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-sex-rituale-bei-der-kampfretter-ausbildung-a-1132072.html.
23 lto.de/recht/nachrichten/n/von-der-leyen-bundeswehr-pfullendorf-vorwuerfe-aufgebauscht-staatsanwaltschaft.
24 stuttgarter-zeitung.de/inhalt.staatsanwaltschaft-hechingen-hat-zweifel-pfullendorfer-skandal-verliert-an-brisanz.126b93fe-24b8-4f25-
b280-071f063ee060.html.
25 thueringer-allgemeine.de/politik/nach-vorfall-in-sondershaeuser-kaserne-von-der-leyen-feuert-chef-ausbilder-des-heeres-id222684493.html,
26 schwaebische.de/politik/aufklaerung-verschleppt-chef-ausbilder-des-heeres-gefeuert-474387.
27 rnd.de/politik/general-spindler-erfuhr-aus-den-medien-von-seiner-absetzung-6KB7J5DBC5ZSQTRTMZQEVAIETQ.html.
28 de.wikipedia.org/wiki/Fall_Franco_A.
29 zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-04/ursula-von-der-leyen-bundeswehr-kritik-haltungsproblem-soldat-terrorverdacht.
30 welt.de/politik/deutschland/article164676815/41-Andenken-an-die-Wehrmacht-gefunden-und-jetzt.html.
Personal der Bundeswehr
Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die eigenartigen politischen, gesellschaftlichen und medialen Rahmenbedingungen vorgeführt wurden, unter denen sich die Bundeswehr behaupten muss, darf man gespannt sein, wie sich ihre Personallage entwickelte.
Kalter Krieg
Die Bundeswehr war ein Produkt des Kalten Krieges. In dieser Zeit bestand ihr Personal aus rund 467.100 aktiven Soldaten, von denen auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges 1970
- im Heer 600 (davon 185.700 Wehrpflichtige – 56,8 Prozent)
- in der Luftwaffe 100 (davon 38.000 Wehrpflichtige – 36,5 Prozent)
- in der Marine 400 (davon 9.000 Wehrpflichtige – 25,0 Prozent)
dienten.1 Sie teilten sich in die drei heute noch vorhandenen Laufbahngruppen ein,
- 300 Offiziere (6,0 Prozent),
- 500 Unteroffiziere (26,7 Prozent),
- 300 Mannschaften (67,3 Prozent).
Von den Mannschaften waren 81.500 Längerdienende, von denen 52.400 auf das Heer entfielen. Von diesen wiederum hatte sich der größte Anteil auf zwei Jahre verpflichtet.1 Dies war nicht wesentlich länger als die 18 oder später 15 Monate Grundwehrdienst, bot jedoch die volle Bezahlung statt des eher einem Taschengeld entsprechenden Soldes eines Wehrpflichtigen.
Die Wehrpflichtigen machten hiernach 50 Prozent des militärischen Personals aus, was auf den ersten Blick die Annahme der Himmeroder Denkschrift zu bestätigen scheint, dass sich im äußersten Fall 250.000 Freiwillige gewinnen lassen würden. Unter realistischer Betrachtung war die Himmeroder Denkschrift jedoch widerlegt: Von den 52.400 länger dienenden Mannschaften des Heeres wäre der größte, wenngleich nicht quantifizierbare Teil ohne Wehrflicht der Bundeswehr ferngeblieben, sodass man damals schon von nur 180.000 bis 190.000 freiwillig dienenden Soldaten auszugehen hatte.
Demografische Entwicklung
Die demografischen Bedingungen waren 1970 gut: In der Bundesrepublik Deutschland lebten damals rund 61 Millionen Menschen,2 von denen 29,7 Prozent weniger als 20 Jahre alt waren.3 Bis heute ging der Anteil von Menschen unter 20 Jahren auf 18,5 Prozent zurück, sank also um ein Drittel.3 Die Bevölkerungszahl stieg zwar auf mittlerweile 84 Millionen Menschen an, ebenfalls um ein Drittel, doch ist dies kein Ausgleich: 12,3 Millionen der in Deutschland lebenden Menschen haben keine deutsche Staatsangehörigkeit,4 die Voraussetzung für den Dienst in der Bundeswehr ist. Nicht ohne Grund treten viele Politiker dafür ein, die Bundeswehr auch für Ausländer zu öffnen.5
Heutige Situation
Derzeit ist für die Bundeswehr ein militärisches Personal von 185.000 geplant, das sich aus
170.000 Zeit- und Berufssoldaten,
12.500 freiwillig Wehrdienstleistenden und
2.500 Reservisten
zusammensetzt. Die Zeitsoldaten (aktuell: 113.386) und Berufssoldaten (aktuell: 57.668) kommen schon zusammen, die freiwillig Wehrdienstleistenden (10.304) sind dagegen zurückhaltend geworden.6 In Anbetracht des Krieges in der Ukraine und der andauernden Diskussion, ob NATO-Truppen dort eingesetzt werden sollen, ist dies nicht erstaunlich.
Die sehr agile Verteidigungsministerin von der Leyen hatte bereits 2016 eine Trendwende Personal proklamiert. Das militärische Personal sollte schrittweise innerhalb von vier Jahren von 185.000 auf 203.000 erhöht werden.
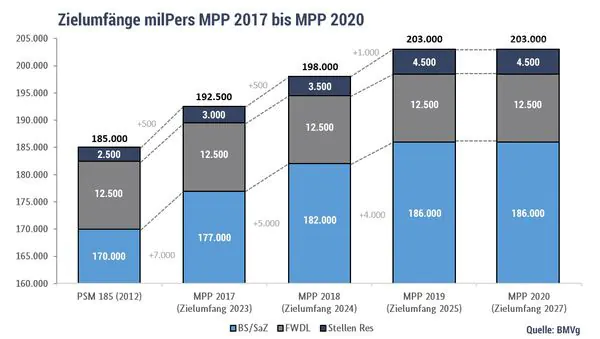
Daraus wurde bekanntlich nichts. Dennoch wird unter dem Eindruck der sogenannten Zeitenwende dasselbe versucht, was zwangsläufig ebenfalls scheitern wird, denn der Rahmen des Möglichen ist nicht größer geworden:
Der Bevölkerung mit deutscher Staatsangehörigkeit ist mit rund 70 Millionen nicht wesentlich größer als 1970, doch sind nur noch 18,5 Prozent unter 20 Jahre alt (12.295.000). 1970 waren es noch 18 Millionen (29,7 Prozent von 61 Millionen). Die für die Personalgewinnung relevante Altersgruppe ist also fast um ein Drittel geschrumpft. Von den 233.000 Freiwilligen des Jahres 1970 sind unter diesem Aspekt rechnerisch sogar nur 155.300 Freiwillige denkbar, wobei allerdings der Anreiz weggefallen ist, sich aus wirtschaftlichen Gründen lieber etwas länger zu verpflichten als Grundwehrdienst zu leisten.
Allerdings darf nicht übersehen werden, dass seit der Aussetzung der Wehrpflicht die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt aus Arbeitnehmersicht geradezu optimal wurden, und zwar aus demselben demografischen Grund der alternden Gesellschaft. Allerdings darf nicht verkannt werden, dass die Arbeitnehmerseite auf dem Arbeitsmarkt mittelfristig womöglich unter Druck gerät, denn Digitalisierung bedeutet zugleich Automatisierung. Die Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen ist womöglich nur eine Vorbereitung der Gesellschaft auf eine künftige Situation, in der nicht mehr jeder von einem Erwerbseinkommen leben kann.7 Dies kann die Bundeswehr womöglich zu einem gefragten Arbeitgeber machen.
Werbung von Ausländern für Bundeswehr
Die Bundeswehr für Ausländer zu öffnen, ist gleich aus mehreren Gründen schwierig: Deren Bereitschaft, sich unter Risiko für das eigene Leben für ein Land zu engagieren, das nicht ihr Heimatland ist und zu dem keine persönliche Verbundenheit besteht, ist von vornherein gering. Bislang beschäftigt lediglich die französische Fremdenlegion Ausländer, zwar mit Erfolg, aber dies gelingt nur durch ein hartes Einschwören auf einen Korpsgeist: Legio patria nostra – die Legion ist unser Vaterland.
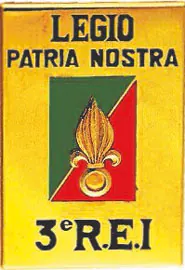
Bild gemeinfrei
Mit den Grundsätzen der Inneren Führung verträgt sich dies nicht, allein weil dadurch ein Staat im Staate entsteht. Die europäischen Staaten haben zudem alle dasselbe demografische Problem, das sich auf ihre Streitkräfte auswirkt, und in etlichen Staaten steht entweder der Wehrdienst für einen fremden Staat oder die Anwerbung für fremden Wehrdienst unter Strafe.8 In Deutschland ist die Werbung fremden Wehrdienst ebenfalls strafbar, § 109h StGB. Umgekehrt in fremden Staaten für den Wehrdienst in Deutschland zu werben, wird dagegen offenbar als unproblematisch gesehen.
Wehrpflichtdebatte und…
Die Wehrpflicht stößt von vornherein an Grenzen, da sich zuletzt – siehe vorn – nahezu zwei Drittel der jeweiligen Jahrgänge den Wehrdienst verweigert hatten. Würde die Wehrpflicht wieder eingefordert, wird dies kaum anders sein.
Russland setzt in der Ukraine keine Wehrpflichtigen ein, da Wehrpflichtige nach russischem Recht nur innerhalb Russlands eingesetzt werden dürfen (wenngleich russische Wehrpflichtige allerdings bedrängt werden, sich als sogenannte Vertragssoldaten zu verpflichten).9 Frisch ausgebildete ukrainische Wehrpflichtige dagegen haben nach ihrem Eintreffen im Kampfgebiet nur noch eine Lebenserwartung von vier Stunden.10 Daraus zieht der Journalist Gernot Kramper den Schluss, die Wehrpflicht sei eine ausgesprochen dumme Idee.11 Dies ist sie auch, es sei denn, man bildet die Wehrpflichtigen gründlich aus. Daran wiederum hindert die Wehrgerechtigkeit:
…Wehrgerechtigkeit
Wer denkt, der Wehrdienst sei zwischen 1990 und 2011 von 15 auf 6 Monate verkürzt worden, weil die Welt in dieser Zeitspanne friedlicher gewesen sei, irrt. Die in völkerrechtlichen Verträgen versprochene Verkleinerung und die infolge der Auslandseinsätze erforderlich gewordene Professionalisierung der Bundeswehr vergrößerte das Problem, dass es immer schon mehr Wehrpflichtige als Bedarf an Wehrpflichtigen gab. Damit zur Wahrung des verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes möglichst jeder Wehrpflichtige einberufen werden konnte, war es erforderlich, die Dienstzeit immer stärker zu verkürzen.
Im Kalten Krieg hielt man zunächst 18 Monate Wehrdienst für angemessen: 3 Monate dauerte die allgemeine militärische Grundausbildung, und weitere 3 Monate waren für die Spezialausbildung vorgesehen, die für die geplante Verwendung des Wehrpflichtigen erforderlich war. Anschließend stand der ausgebildete Soldat 12 Monate lang der Truppe zur Verfügung.12 Aus Sicht der Truppe war dies optimal. Um das Wehklagen über die verlorene Lebenszeit zu beschwichtigen, wurde der Dienst auf 15 Monate verkürzt, indem die allgemeine Grundausbildung auf 6 Wochen zusammengedrängt wurde. Zuletzt dauerte der Grundwehrdienst nur noch 6 Monate. Dies entwertet die Wehrpflichtigen für die Truppe erheblich. Ukrainische Wehrpflichtige müssen nach drei Monaten bereits in den Kampfeinsatz. Was dabei herauskommt, steht oben.
Bedarf an Wehrpflichtigen
Die Marine hatte – siehe oben – schon im Kalten Krieg keinen Bedarf an Wehrpflichtigen. Die heutigen Kriegsschiffe sind vollautomatisiert und fahren mit einem Drittel der Besatzungen, die vor 1990 noch erforderlich waren. Ihr Bedarf ist von Qualifizierung geprägt, nicht von Quantität. Bei der Luftwaffe ist es mittlerweile ähnlich, weil die bodengestützten Truppenteile, die kurz ausgebildete Wehrpflichtige beschäftigen konnten, überwiegend weggefallen sind.
Umso stärker wirkte sich die Aussetzung der Wehrpflicht auf das Heer aus, das 2011 schlagartig fast ohne Mannschaften dastand: Der größte Teil der Trupps und Gruppen der Infanterie, der Panzerbesatzungen, der Geschützbedienungen usw. bestehen jedoch aus Mannschaftsdienstgraden. U. a. dies führte zu einer organisatorischen Veränderung der gesamten Bundeswehr, die ihr nicht bekommen ist. Sie wird im Kapitel Organisation erläutert.

Kreiswehrersatzamt Ravensburg, Foto: Andreas Praefcke – CC BY 3.0, commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15968563
Personalkosten
Die Personalkosten der Bundeswehr – einschließlich Ruhestandsbezüge und Beiträge für soziale Sicherheit – beliefen sich 2024 auf 16,1 Milliarden Euro.13 Die Wehrpflicht ist keineswegs die billigere Alternative: Ihr Vollzug erfordert einen erheblichen Verwaltungsaufwand, vor allem die Wiedererrichtung der Kreiswehrersatzämter zur Erfassung und Musterung der Wehrpflichtigen sowie der Kommissionen für die Gewissensprüfung der Wehrdienstverweigerer. Die Kosten einer solchen Verwaltungsorganisation sind schwer einschätzbar. Zuletzt gab es 2011 noch 52 Kreiswehrersatzämter mit 4.100 Dienstposten. Insgesamt, schätzte das Bundesfinanzministerium 2024, würden durch die Wiedereinführung der Wehrpflicht zusätzliche direkte Staatsausgaben von 0,6 bis 12,8 Milliarden Euro entstehen.13
Vorschlag
Realistisch sind unter den gegenwärtigen Bedingungen, die oben aufgezeigt wurden, auf Dauer nur 170.000 freiwillige Soldaten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Von mehr gewinnbaren Soldaten darf eine nachhaltige Planung allein aus demografischen Gründen nicht ausgehen. Die Lösung wird darin bestehen (müssen), dass zumindest beim Heer alle Offiziere und Unteroffiziere erst 2 Jahre als Mannschaften dienen müssen, bevor ihre laufbahnbezogene Ausbildung beginnt. Von diesen 2 Jahren können dann wieder 6 Monate auf die allgemeine Grundausbildung und die verwendungsbezogene Spezialausbildung entfallen.
Damit wird sich der Bedarf an Mannschaften indes nicht abdecken lassen. Statt des derzeit angebotenen freiwilligen Wehrdiensts sollte eine zweijährige Dienstzeit treten, deren Ableistung zu Vorteilen im Zivilleben führt. Soldaten, die anschließend ein Studium aufnehmen möchten, könnten beispielsweise unter Abänderung des § 11 Abs. 3 BAföG bereits nach Ableistung des zweijährigen Dienstes Leistungen nach dem Berufsausbildungsförderungsgesetz ohne Berücksichtigung des Elterneinkommens gewährt werden, was zu finanzieller Unabhängigkeit führt. Für die Ableistung eines 3. Jahres kann die Studienabschlusshilfe auf 18 Monate ausgedehnt und Rückzahlpflicht für die Darlehensanteile der Leistung von vornherein erlassen werden. Angehende Selbständige könnten etwa mit wesentlich höheren zinsfreien Krediten gefördert werden, als sie sonst zu erwarten hätten. Welche Vergünstigungen im Einzelnen tatsächlich in Aussicht gestellt werden, ist eine Frage eines Einfallsreichtums, der je nach politischem Willen größer oder kleiner ausfällt.
Für die Bundeswehr sind die ehemaligen Soldaten eine fertig ausgebildete Reserve, und für die ehemaligen Soldaten kann sie eine soziale Rückversicherung bieten, wenn sie ihnen die Rückkehr in ihren Dienst ermöglicht und ihnen für diesen Fall sämtliche Laufbahngruppen eröffnet.
Quellen und weiterführende Hinweise (letzter Abruf 30. November 2024):
1 Emil Obermann, Gesellschaft und Verteidigung, 1970, Seite 722.
2 de.statista.com/statistik/daten/studie/696696/umfrage/zahl-der-einwohner-in-deutschland-im-frueheren-bundesgebiet.
3 bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61541/bevoelkerungsentwicklung-und-altersstruktur.
4 demografie-portal.de/DE/Fakten/auslaender-regional.html.
5 Zu den wechselseitigen Argumenten: reservistenverband.de/magazin-loyal/pro-contra-auslaender-bundeswehr.
6 bundeswehr.de/de/ueber-die-bundeswehr/zahlen-daten-fakten/personalzahlen-bundeswehr.
7 bpb.de/themen/medien-journalismus/netzdebatte/222285/debatte-bedingungsloses-grundeinkommen.
8 Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags WD-7-3000-028/22 vom 19. Mai 2022: Strafbarkeit des Beitritts Einzelner
zu einer fremden Streitkraft, online bundestag.de/resource/blob/900304/6702d096df994540a99d20895ed0c549/WD-7-028-22-pdf-
data.pdf.
9 de.euronews.com/my-europe/2024/10/01/mobilisierung-in-russland-wie-viele-der-133000-rekruten-mussen-in-die-ukraine.
10 businessinsider.de/politik/ukraine-krieg-soldaten-an-der-front-leben-im-schnitt-4-stunden.
11 stern.de/politik/wehrpflicht–der-ukrainekrieg-zeigt-die-schattenseiten-des-dienstes-34755636.html.
12 Emil Obermann, ebenda, Seite 773 f.
13 bundeshaushalt.de/static/daten/2024/soll/epl14.pdf, Seite 24.
14 Gutachten von Joop Adema, Panu Poutvaara, Marcel Schlepper, Tuncay Taghiyev, Timo Wochner, Volkswirtschaftliche Kosten einer
Wiedereinführung der Wehrpflicht oder eines sozialen Pflichtjahrs, Seite 37 ff., ifo-Kurzexpertise,
online bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Oeffentliche-Finanzen/Studien-Kurzexpertisen/
ifo-studie-kosten-wiedereinfuehrung-wehrpflicht.pdf?__blob=publicationFile&v=3.
Organisation der Bundeswehr
Nach dem Kalten Krieg verkleinerte sich die Bundeswehr aufgrund völkerrechtlicher Verträge von rund 500.000 auf 370.000 aktive Soldaten. Ihre Grundorganisation veränderte sie nicht.1 Sie bestand – wie fast alle Streitkräfte weltweit – aus den Teilstreitkräften
- Heer,
- Luftwaffe
- Marine
Die Bundeswehrkrankenhäuser waren als ortsfeste Lazarettorganisation dem Inspekteur des Sanitäts- und Gesundheitswesens der Bundeswehr unterstellt.2 Daneben gab es noch ein Netz von Munitions-, Betriebsstoff- und Materialdepots sowie Werkstätten zur Materialerhaltung.3
Ab 2000: Transformation der Bundeswehr
Ab 2000 wurde von der NATO die sogenannte Transformation ausgerufen, wonach sich die Streitkräfte aller NATO-Staaten in die Lage versetzen sollten, weltweit intervenieren zu können. Die nach ihrem Verfassungsauftrag in Artikel 87a Abs. 1 Grundgesetz strikt auf die Landesverteidigung ausgerichtete Bundeswehr reagierte darauf mit ebenso viel Ratlosigkeit wie Aktionismus. Die Politik erkannte richtig, dass die grundsätzlich pazifistisch denkende deutsche Gesellschaft Auslandseinsätze nicht ohne Protest hinnehmen würde, weshalb sich der damalige Verteidigungsminister Struck in die gewagte These verstieg, die freiheitlich-demokratische Grundordnung würde auch am Hindukusch verteidigt.4 Vor der Entsendung von Kampftruppen in ferne Länder schreckte die Politik dennoch zurück. Wenn man sich schon an Auslandseinsätzen beteiligen müsste, dann wenigstens mit Truppen, die keinen Schaden anrichten (wie technische Unterstützungskräfte) oder den Einsätzen gar einen humanitären Anstrich verleihen (etwa Sanitäter). So entstand im Oktober 2000 eine neue Gesamtorganisation mit fünf sogenannten Organisationsbereichen
- Heer
- Luftwaffe
- Marine
- Streitkräftebasis
- Zentraler Sanitätsdienst
In der Streitkräftebasis wurden vor allem Fernmelde-, Logistik-, Nachschub- und Instandsetzungskräfte zusammengefasst, die im Heer nicht mehr unbedingt benötigt wurden, aber für einen Beitrag zu Auslandseinsätzen geeignet erschienen. Deshalb wurden zugleich auch die Sanitätskräfte aus den Teilstreitkräften ausgegliedert und im Zentralen Sanitätsdienst zusammengefasst, der bald auf etwa ein Drittel der Stärke des Heeres anwuchs.
Ab 2012: Neuausrichtung der Bundeswehr
Ab 2012 durchlief die Bundeswehr die vom Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg geplante Reform Neuausrichtung der Bundeswehr. Dafür bezeichnete der frühere Verteidigungsminister Volker Rühe seinen Nachfolger zu Guttenberg 2019 als den Mann, der die Bundeswehr zerstört hat.5 Dieses harte Urteil wird als ungerecht empfunden, denn zu Guttenbergs Nachfolgerin von der Leyen hatte 2017 erst vervollständigt, was Rühe als Zerstörung bezeichnete. Die Bundeswehr bestand nun aus sechs militärischen Organisationsbereichen,
- Heer
- Luftwaffe
- Marine
- Streitkräftebasis
- Zentraler Sanitätsdienst
- Cyber- und Informationsraum
sowie aus den drei zivilen Organisationsbereichen
- Personal
- Ausrüstung, Informationstechnik, Nutzung,
- Infrastruktur, Umweltschutz, Dienstleistungen
Im 2017 errichteten Organisationsbereich Cyber- und Informationsraum wurden die frühere Fernmeldetruppe, die Kräfte der elektronischen Kampfführung sowie alle Dienststellen zusammengeführt, die im weitesten Sinne mit Informationstechnik befasst sind. Die Idee dazu kam nicht von Militärs, sondern von Frau Dr. Katrin Suder und Dr. Grundbert Scherf,6 zwei McKinsey-Mitarbeitern, die für ihre Tätigkeit für das Bundesministerium der Verteidigung vorübergehend verbeamtet worden waren.7 Die zivilen Organisationsbereiche sind Oberbehörden des Bundes.8 Im Grunde wuchs das Bundesministerium der Verteidigung mit einem opulenten nachgeordneten Bereich sogar zu einem zehnten Organisationsbereich auf. Im Augenblick (Dezember 2024) gilt diese Organisationsstruktur noch. Am 31. Oktober 2024 war die Personalausstattung der Organisationsbereiche folgende:9
| Organisationsbereich | Militär-
personal |
Zivil-
personal |
| Bundesministerium der Verteidigung* | 8.367 | 4.339 |
| Heer | 61.894 | 2.501 |
| Luftwaffe | 27.134 | 4.765 |
| Marine | 15.424 | 1.828 |
| Streitkräftebasis | 22.885 | 6.506 |
| Zentraler Sanitätsdienst | 20.395 | 4.432 |
| Cyber- und Informationsraum | 13.748 | 1.790 |
| Personal | 7.679 | 10.215 |
| Ausrüstung, Informationstechnik, Nutzung | 1.922 | 11.750 |
| Infrastruktur, Umweltschutz, Dienstleistungen | 985 | 32.948 |
* einschließlich nachgeordneter Dienststellen
Mit 181.630 Soldaten sowie 81.635 Beamten und Arbeitnehmern erreicht die Bundeswehr ihre geplante Personalstärke von 185.000 Soldaten nicht ganz. Dass diese Organisationsstruktur unhandlich und für die Landesverteidigung unpassend ist, muss nicht hervorgehoben werden, sondern wurde seit 2019 von der Bundeswehr selbst immer wieder angemerkt.
Bis 2025: Zeitenwende
Man wird den vormaligen Verteidigungsministerinnen von der Leyen, Kramp-Karrenbauer und Lamprecht nicht zu nahe treten, wenn man annimmt, dass sie von militärischen Angelegenheiten gar nichts verstehen und vor ihrem Amtsantritt noch nie einen Grund hatten, sich mit militärischen Fragen auseinanderzusetzen. Erst der Frau Lamprecht nachfolgende, sich als besonders agil und anpackend empfehlende Herr Pistorius wagt derzeit eine Reform der Bundeswehrorganisation, die im April 2025 abgeschlossen sein soll. Hiernach wird es 4 Teilstreitkräfte geben,
- das Heer mit 64.000 militärischen und zivilen Kräften,
- die Luftwaffe mit 32.000 militärischen und zivilen Kräften,
- die Marine mit 17.000 militärischen und zivilen Kräften,
- den Cyber- und Informationsraum mit 15.000 militärischen und zivilen Kräften.
Der sogenannte Cyber- und informationsraum ist nach seiner Auffassung nämlich wie Land, Luft und See ein echter, in sich geschlossener Kampfraum. Dies wird zwar in allen anderen Streitkräften der Welt nicht so gesehen, ist aber ein achtbarer Standpunkt. In einem bis dahin neu gegründeten
- Organisationsbereich Unterstützung mit 55.000 militärischen und zivilen Kräften
werden die bisherige Streitkräftebasis und der Zentrale Sanitätsdienst zusammengelegt. Die drei zivilen Organisationbereiche bleiben dagegen, wie sie sind.10 Damit wird, wie ein Vergleich der geplanten Personalzahlen mit denen in der vorangegangenen Tabelle zeigt, die Bundeswehr nicht größer, und ihre Organisationsstruktur verändert sich im Grunde überhaupt nicht.
Herr Pistorius stieß bei seiner Reform auf – wahrscheinlich von ihm nicht erwarteten – Widerstand, vor allem von der Ärztelobby, die die Auflösung des Zentralen Sanitätsdiensts nicht hinnehmen wollte.11 Die Auflösung des 2017 unter Merkel und von der Leyen ersonnenen Cyber- und Informationsraum wäre ein Affront gegen die CDU gewesen, mit der die SPD im Grunde seit 2005 in einer nur gelegentlich unterbrochenen Großen Koalition regiert. Von dieser Seite hätte die Kritik gelautet, Pistorius sei technisch nicht auf der Höhe der Zeit und könne offenbar nicht begreifen, wie fortschrittlich das doch sei. In der Politik geht es in erster Linie um Machterhalt und Machtoptionen. Um die Sache geht es, wenn überhaupt, in zweiter Linie. An diesen Regeln kann auch Herr Pistorius nichts ändern.
Quellen und weiterführende Hinweise (letzter Abruf 7. Dezember 2024):
1 Otfried Nassauer, Militärplanung nach der Wiedervereinigung in: Erich Schmidt-Eenboom, Jo Angerer, Siegermacht NATO – Dachverband
der neuen Weltordnung, 1993, Seiten 115 ff.
2 Emil Obermann, Gesellschaft und Verteidigung, 1970, Seite 817 f.
3 Emil Obermann, ebenda, Seite 813 f.
4 bundesregierung.de/breg-de/service/newsletter-und-abos/bulletin/
rede-des-bundesministers-der-verteidigung-dr-peter-struck—784328.
5 spiegel.de/politik/deutschland/volker-ruehe-wirft-karl-theodor-zu-guttenberg-zerstoerung-der-bundeswehr-vor-a-1252538.html,
tagesspiegel.de/politik/guttenberg-hat-die-bundeswehr-zerstort-5543008.html,
merkur.de/politik/guttenberg-csu-ex-minister-attackiert-ihn-mit-schweren-vorwuerfen-zr-11725867.html.
6 bmvg.de/de/aktuelles/auftrag-cyber-verteidigung-11414,
bmvg.de/de/aktuelles/aufbaustab-cyber-und-informationsraum-nimmt-arbeit-auf-11560.
7 de.wikipedia.org/wiki/Katrin_Suder#Sogenannte_Berateraffäre_des_Bundesministeriums_der_Verteidigung,
augengeradeaus.net/2014/08/die-neuen-player-in-der-ruestungspolitik-suder-scherf-zimmer-und-gabriel.
8 de.wikipedia.org/wiki/Organisationsbereich_(Bundeswehr).
9 bundeswehr.de/de/ueber-die-bundeswehr/zahlen-daten-fakten/personalzahlen-bundeswehr.
10 bundeswehr.de/de/organisation.
11 aerzteblatt.de/nachrichten/149607/Bundeswehr-Mobilmachung-gegen-geplante-Umstrukturierung-des-Sanitaetsdienstes.
Rüstungswirtschaft
Nach Art. 87b des Grundgesetzes hat die Beschaffung der Ausrüstung der Bundeswehr durch zivile Behörden zu erfolgen. Dies funktionierte bis 2000 recht zufriedenstellend, doch gibt es seitdem Schwierigkeiten. Militärgerät ist kostspielig. Ironischer Weise steigen die Preise, je friedlicher es auf der Welt zugeht.
Irrtum: Friedensdividende
Bei jedem Industrieprodukt fallen Kosten für jahrelange Entwicklung mitsamt dem Bau von Prototypen, Versuchen und immer neuen Verbesserungen an, bevor es schließlich auf dem Markt angeboten und serienmäßig hergestellt werden kann. Bei millionenfach hergestellten Produkten wie Automobilen fallen diese Kosten nicht sichtbar ins Gewicht, weil sie auf eine große Stückzahl verteilt werden. Rüstungsgüter werden dagegen in relativ kleinen Serien hergestellt. Hier war noch nie von Millionen Stück die Rede. Im Kalten Krieg ging es beispielsweise bei Kampfpanzern noch um 2.200 Stück für 2,3 Millionen DM je Stück.1 Heute – sogar nach der Zeitenwende – geht es nur um 105 Stück für zusammen 2,9 Milliarden Euro, somit 27,6 Millionen Euro je Stück.2 Von der Luft-Luft-Rakete IRIS-T, die zur Ausrüstung des EUROFIGHTER gehört, wurden nach Angabe des Herstellers Diehl Defense bislang 4.000 Stück gebaut. Der Stückpreis beträgt 400.000 Euro. Davon entfallen 46 Prozent, fast die Hälfte, auf Entwicklungskosten.3

Rakete IRIS-T, Foto: HaraF, IRIS-T expo front.JPG
Wären mehr dieser Raketen bestellt worden, hätte der Hersteller den Stückpreis niedriger kalkulieren können. Die verallgemeinernde Faustregel lautet daher: Je weniger Stück von einem Rüstungsgut bestellt werden, desto höher fällt der Stückpreis aus. Sie bestätigt sich ohne Ausnahme durch alle Rüstungsvorhaben der Bundeswehr seit 2000. Eine Friedensdividende gibt es bei Rüstungsgütern nicht.
Ausschreibungsverfahren
Die Bundeswehr ist gesetzlich gehalten, jede Beschaffung auszuschreiben. Ihre Dienststellen verwenden viel Arbeitszeit darauf, den Katalog an Anforderungen und technischen Vorgaben möglichst präzise zu formulieren. Genauso arbeitsintensiv wird hierdurch die Angebotserstellung für die Industrie. Mittlerweile nehmen Bieter nur noch an Ausschreibungen teil, wenn ihnen für den Fall der Ablehnung ihres Angebots eine Entschädigung für den mit der Angebotserstellung verbundenen Aufwand versprochen wird. In der Ausschreibung der Fregatte F-126 waren deshalb 12 Millionen Euro für jeden Anbieter vorgesehen, der sich die (erhebliche) Mühe machte, ein Angebot abzugeben.4 Sinn der Ausschreibungsverfahren ist es, das wirtschaftlich günstigste Angebot zum Zug kommen zu lassen. Ob dieses Ziel bei derartigen Handhabungen wirklich erreicht wird, ist fraglich. Die Auswahl der Hersteller folgt letztlich politischem Kalkül.
Arbeitsplätze
Eine Alternative zum 8,5 Millionen Euro teuren und überhaupt weltweit teuersten Schützenpanzer PUMA5 wäre der schwedische CV-90 gewesen, mit dem alle skandinavischen Staaten, Tschechien, die Schweiz sowie die Niederlande ihre Streitkräfte ausgestattet haben. Sein Preis liegt mit 4 Millionen Euro bei weniger als der Hälfte des Preises für einen PUMA.6 Schlechter ist er dennoch nicht.

Deutscher Schützenpanzer PUMA für 8,5 Millionen Euro
Foto: Ein Dahmer, BADEN-WURTTEMBERG 00257 (cropped).jpg

Schwedischer Schützenpanzer CV90 für 4 Millionen Euro
Foto: Ekeb, CV9030 finnish.png
Vor der Bestellung der Fregatten der Baden-Württemberg-Klasse hatte der Bundesrechnungshof 2007 den von der deutschen Schiffbauindustrie verlangten Preis von 650 Millionen Euro je Schiff kritisiert: Er verwies auf Dänemark, das zur gleichen Zeit vergleichbare Schiffe, die Absalon-Klasse, für weniger als 300 Millionen Euro gebaut hatte. Der Haushaltsausschuss des Bundestages überhörte dies und genehmigte den Bau der F-125 ohne weiteres.7 Bis zur Auslieferung verteuerten sich die deutschen Schiffe zusammen um 1,26 Milliarden Euro.8

Deutsche Fregatte F-125 für 950 Millionen Euro
Foto: Ein Dahmer, BADEN-WURTTEMBERG 00257 (cropped).jpg

Dänische Fregatte Absalon für 300 Millionen Euro
Foto: Dänische Marine, L16 HDMS Absalon – 20070902.jpg
Damit soll der Kritik vorgebeugt werden, wenn schon Milliarden ausgegeben werden, müssten damit wenigstens deutsche Arbeitsplätze gesichert werden. Beim Schiffsbau soll der deutschen Werftindustrie geholfen werden: Arbeitslose Werftarbeiter kosten den Staat gleichfalls Geld, und als Arbeitslose könnten die Werftarbeiter womöglich einer sozial ausgerichteten Partei ihre Stimme geben. Wirtschaftliche Aspekte werden zur Nebensächlichkeit, wenn politische Interessen eine Rolle spielen. Dann werden Rüstungsaufträge zur verdeckten Subvention.7 Diese politische Logik kennt allerdings eine Ausnahme, wenn es nämlich um amerikanische Produkte für die Luftwaffe geht: Sie sind nicht billiger als deutsche, doch festigen Einkäufe bei amerikanischen Herstellern die transatlantische Freundschaft.
Rüstungsunternehmen
Am Ende der Ausschreibungsverfahren kommen letztlich immer dieselben Anbieter zum Zuge: Bei gepanzerten Fahrzeugen sind dies Krauss-Maffay-Wegmann (KMW, jetzt KNDS Deutschland) und Rheinmetall. Um den Radpanzer BOXER anzubieten, gründeten beide Unternehmen die gemeinsame ARTEC GmbH, oder sie treten als Bietergemeinschaft auf. Auf ihren Internetseiten stellen beide Unternehmen ungefähr dieselbe Produktpalette als ihre Produkte vor, darunter den LEOPARD 2 als Kampfpanzer oder den PUMA als Schützenpanzer.8 Raketen und Flugkörper kommen von Diehl Defence aus Überlingen9 oder von MDBA Deutschland aus Wolfratshausen,10 große Schiffe von ThyssenKrupp Marine Systems,11 kleinere von Lürssen,12 Handwaffen von Heckler & Koch.13 Allenfalls bei den Handwaffen gibt es noch C. G. Haenel aus Suhl als denkbaren Anbieter.14
Sonst gibt es jedoch keine Unternehmen, die diesen Herstellern ernsthaft Konkurrenz machen wollen: Das Risiko, eigene Produkte mit hohem Aufwand zu entwickeln und dann doch nicht zum Zuge zu kommen, ist viel zu groß. Von einem wirklichen Wettbewerb zu sprechen, fällt in Anbetracht des sehr kleinen Herstellerfelds schwer. Das Ausschreibungsverfahren wirkt daher wie eine Formalie, für deren Kosten (das ist: der Haushalt für die rund 6.000 Beamten und Mitarbeiter des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr) der Steuerzahler aber gleichfalls aufkommen muss.
Immer teurer, immer später, immer schlechter
Die 2010 eingesetzte Strukturkommission fand: Die Streitkräfte erhalten ihre geforderte Ausrüstung zumeist weder im erforderlichen Zeit- noch im geplanten Kostenrahmen.15 Dies war nicht immer so. Verfolgt man die Veränderungen der Beschaffungsverwaltung die davorliegenden zehn Jahre zurück, stößt man auf das 2001 vom damaligen Verteidigungsminister Scharping eingeführte Customer Product Management (CPM). Dabei handelt es sich um ein vorgegebenes Verfahren zur Bedarfsermittlung und Bedarfsdeckung der Bundeswehr mit Produkten und Dienstleistungen: Es verlangt einen strikt vorgegebenen Ablauf von Entscheidungsprozessen, der schematisch eingehalten und dokumentiert werden muss.15 Dies führte zu einer gewissen Schwerfälligkeit der Beschaffungsverwaltung.
Am 31. Juli 2016 erschien in DER SPIEGEL Konstantin von Hammersteins Artikel Belgisch Block. Darin wird ein Eindruck von den festgefahrenen Denk- und Arbeitsabläufen der Beschaffungsverwaltung der Bundeswehr vermittelt und zugleich von der guten Absicht der Rüstungsstaatssekretärin Dr. Katrin Suder, die bis dahin bei McKinsey gearbeitet hatte, berichtet, den notorisch skandalträchtigen Rüstungsbereich zu reformieren.16 2018 gab Dr. Suder das Amt als Rüstungsstaatssekretärin zurück, weil sie keine Erfolgsaussicht mehr sah. An ihr wird es nicht gelegen haben, und ihr Scheitern wird auch nur zum Teil durch das festgefahrene CPM der Beschaffungsbehörde zu erklären sein. Hauptgrund wird dagegen das monopolähnliche Wesen der deutschen Rüstungsindustrie sein, die ihre Vertragsbedingungen und ihre Preise geradezu selbstherrlich festlegen kann. Konkurrenz gibt es nur im Ausland, doch mit Rücksicht auf deutsche Arbeitsplätze wagt kein Politiker, dort einzukaufen. Auch in der Zeitenwende blieb dies so, weshalb beispielsweise die Aktie des Rüstungsunternehmens Rheinmetall, die Anfang April 2020 noch bei rund 59 Euro notiert wurde, am 6. Dezember 2024 mit 661 Euro ihren historischen Höchststand erreichte.17
Die Marzipan-Armee
Die Skandale, unter denen das Ansehen der Bundeswehr von Anfang an litt, waren fast immer Rüstungsskandale. Der damalige Herausgeber des SPIEGEL, Rudolf Augstein, schrieb dazu 1966:18 Freilich, eine Armee, die so gegründet wird, deren Flugzeuge fallen vom Himmel, deren Panzerketten klirren auseinander, deren U-Boote bestehen aus untauglichem Material, deren Minister stellen sich nicht vor ihre Untergebenen, deren Generale maulen und mosern, deren Disziplinargerichte werden vom Minister missachtet, deren Oberbefehlshaber lässt Bürger verhaften, belügt den Bundestag und betrinkt sich in jener einzigen Nacht, in der es wirklich Krieg geben kann: Eine solche Armee formiert sich, mit den Worten eines ihrer Generale – es war beim letzten großen Zapfenstreich für einen hochmögenden Versager -, zu einer „Marzipan-Armee“, deren, Gott soll schützen, Bewährungsprobe ähnlich ausgehen könnte wie die der ägyptischen Armee im Feldzug gegen Israel.

Großer Zapfenstreich für Christine Lamprecht, Foto: picture alliance/dpa
Mit der Ehre eines Großen Zapfenstreichs verabschiedete die Bundeswehr auch Angela Merkel, Rudolf Scharping, Karl Theodor zu Guttenberg, Ursula von der Leyen, Annegret Kramp-Karrenbauer und Christine Lamprecht.
Quellen und weiterführende Hinweise (letzter Abruf 7. Dezember 2024):
1 de.wikipedia.org/wiki/Leopard_2#Leopard_2AV.
2 bmvg.de/de/aktuelles/leopard-2-a8-neue-kampfpanzer-fuer-die-brigade-litauen-5810986.
3 de.wikipedia.org/wiki/IRIS-T#Nutzer.
4 Ausschreibungstext auf ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:252505-2015:TEXT:DE:HTML.
5 faz.net/aktuell/politik/inland/f-a-z-exklusiv-schuetzenpanzer-puma-endlich-einsatztauglich-17251869.html.
6 augsburger-allgemeine.de/panorama/cv-90-panzer-schuetzenpanzer-fuer-ukraine-portraet-daten-preis-id65466416.html.
7 Andreas Flocken, Subventionspolitik durch die Bundeswehr? Marine bekommt F 125 Fregatten für mehr als zwei Milliarden Euro Gastbeitrag
für MDR Info am 30. Juli 2007 (online noch verfügbar auf bits.de/public/gast/07flocken-03.htm).
8 faz.net/aktuell/politik/inland/fregatte-der-deutschen-marine-teuer-spaet-und-bedingt-einsatzbereit-18170123.html.
8 kmweg.de und rheinmetall.com.
9 diehl.com/defence/de.
10 mbda-deutschland.de/produkte.
11 thyssenkrupp-marinesystems.com.
12 nvl.de/en/naval-vessels.
13 heckler-koch.com/de.
14 cg-haenel.de/defence.
15 de.wikipedia.org/wiki/Customer_Product_Management.
16 online: spiegel.de/politik/belgisch-block-a-ce7cb53c-0002-0001-0000-000146047943.
17 google.com/finance/quote/RHM:ETR?sa=X&ved=2ahUKEwj-p-qH-JeKAxV2xgIHHdaWAGwQ3ecFegQIQhAh&window=MAX.
18 Rudolf Augstein, HS 30 oder wie man einen Staat ruiniert in: DER SPIEGEL Heft 44/1966 (online: spiegel.de/politik/hs-30-oder-wie-man-
einen-staat-ruiniert-a-a93a7879-0002-0001-0000-000046414788).
Verteidigungshaushalt
Der Verteidigungshaushalt ist der Einzelplan 14 des Bundeshaushalts. Er sah in den Jahren 2016 bis 2023 folgende Ausgaben vor:
| Ausgabenpositionen | 20161
Mio. Euro |
20191
Mio. Euro |
20211
Mio. Euro |
20232
Mio. Euro |
| Personalausgaben | 11.378,8 | 12.841,9 | 13.230 | 14.155,4 |
| Versorgungsaufwendungen | 5.675,7 | 5.998,4 | 6.140 | 6.558,1 |
| Materialerhaltung | 2.850,0 | 4.432,1 | 4.530 | 5.364,0 |
| Sonstige Betriebsausgaben2 | 6.193,9 | 7.349,6 | 8.020 | 9.013,8 |
| Betreiberverträge | 1.797,8 | 2.728,7 | 3.400 | 3.875,0 |
| Forschung und Entwicklung3 | 747,1 | 1.476,6 | 1.660 | 1.848,9 |
| Militärische Beschaffungen | 4.672,5 | 6.787,0 | 8.690 | 8.037,8 |
| Militärische Anlagen4 | 860,7 | 1.176,0 | 1.330 | 1.437,5 |
| Sonstige Investitionen5 | 190,0 | 437,4 | 1.890 | 414,4 |
| Haushalt insgesamt | 34.366,3 | 43.227,8 | 46.970 | 50.104,9 |
Der kleinste Verteidigungshaushalt war 2013 mit 32,81 Milliarden Euro aufgelegt worden, der Haushalt 2022 war mit 50,4 Milliarden Euro noch etwas größer.3 2022 machte der Verteidigungshaushalt 1,4 Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts aus.4 Um dem Zwei-Prozent-Ziel der NATO zu entsprechen, müssten rechnerisch hiernach 71,57 Milliarden ausgegeben werden. Weltweit betragen die Verteidigungsausgaben durchschnittlich 2,2 Prozent der Bruttoinlandsprodukte.4 Die Bezeichnungen der meisten in der vorstehenden Tabelle genannten Haushaltstitel sind selbsterklärend. Zwei davon sind wahrscheinlich erklärungsbedürftig:
Sonstige Betriebsausgaben
Von den in der 5. Zeile obiger Tabelle genannten sonstigen Betriebsausgaben entfielen 2019 rund 2.600 Mio. Euro (35,3 Prozent dieser Position) auf Mieten und Pachten, die das Bundesministerium der Verteidigung für Kasernen und sonstige Liegenschaften an die zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Finanzen gehörende BImA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) bezahlt.5 Somit handelt es sich bei diesen Zahlungen nicht um wirkliche Geldabflüsse aus dem Bundeshaushalt, sondern nur um einen Geldaustausch von Resort zu Resort (vgl. Kapitel 1408 des Einzelplans 14).
Betreiberverträge
Zu den in der 6. Zeile genannten Betreiberverträgen zählen u. a. die Ausgaben für die im Geschäftsbereich des Verteidigungsministeriums vorhandenen privatrechtlichen Gesellschaften. Diese decken zum großen Teil den Bedarf der Bundeswehr an Mobilität (Bw FuhrparkService GmbH6), an Bekleidung und persönlicher Ausrüstung (Bw Bekleidungsmanagement GmbH6), an Instandsetzungsleistungen für landgebundenes Material (HIL Heeresinstandsetzungslogistik GmbH6) sowie an Informationstechnik (BWI GmbH6) ab.7
Partner bei Betreiberverträgen sind aber auch fremde Unternehmen, die Anlagen oder Waffensysteme der Bundeswehr gegen Geld bewirtschaften, etwa das Gefechtsübungszentrum des Heeres (mit Saab) oder Aufklärungsdrohnen und Kommunikationssatelliten (mit Airbus).
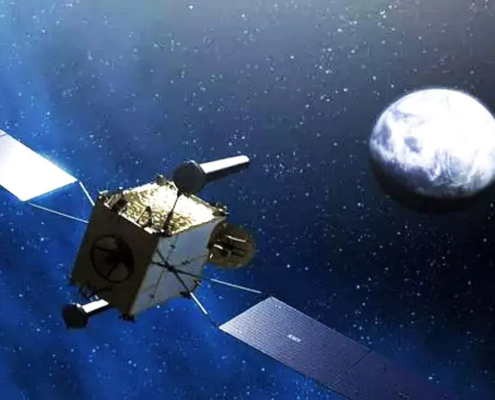
ComSat-Satellit, Foto: Airbus
Beiträge zur NATO
Kosten, die durch die NATO-Mitgliedschaft anfallen, werden im Kapitel 1401 des Einzelplans 14 aufgeschlüsselt, finden sich aber auch in anderen Kapiteln. 2020 betrugen sie 1.752,1 Mio. Euro.
| Benennung Kapitel 1401 | Mio. Euro | Benennung Kapitel 1401 | Mio. Euro |
| Beitrag NATO-Haushalt | 120,6 | NATO-Investitionsprogramm | 98,0 |
| Beitrag NATO-Stäbe | 23,6 | AGS-Einrichtung in Italien* | 23,6 |
| Internationale Organisationen | 52,6 | Beitrag AWACS** | 120,2 |
| NATO-Pipeline-System | 18,9 | Beitrag MRTT*** | 178,2 |
| Mitnutzung Anlagen | 116,4 | Internationale Einsätze | 770,0 |
| Afghanische Sicherheitskräfte | 80,0 | Baukosten für NATO | 150,0 |
* dazu PDF Luftwaffe, Kapitel Drohnen,
** dazu PDF Luftwaffe, Kapitel Luftgestützte Luftraumüberwachung
*** dazu PDF Luftwaffe, Kapitel Lufttransportverbände.
Sondervermögen
Nicht zum laufenden Haushalt gehört das nun in Art. 87a Abs. 1a GG verankerte Sondervermögen. Ein Sondervermögen ist ein wirtschaftlich verselbständigter Nebenhaushalt, der ausschließlich zur Erfüllung einzelner begrenzter Aufgaben des Bundes in einer besonderen Situation bestimmt ist und deshalb vom sonstigen Bundesvermögen getrennt verwaltet werden muss. Die Ausgaben des Sondervermögens sind streng zweckgebunden. Zur Deckung der Ausgaben kann der Bund ermächtigt werden, Kredite aufzunehmen. Sondervermögen dürfen nur durch Gesetz errichtet werden und unterliegen der Kontrolle durch den Bundestag, den Bundesrat und den Bundesrechnungshof.8
Drei Tage nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine fand am 27. Februar 2022 eine Sondersitzung des Deutschen Bundestages statt. Bundeskanzler Olaf Scholz gab eine Regierungserklärung ab, in der er eine radikale Neuausrichtung der deutschen Sicherheits- und Außenpolitik ankündigte (sogenannte Zeitenwende-Rede).9 Zur besseren Ausstattung der Bundeswehr schlug er ein mit Kredit finanziertes Sondervermögen im Umfang von hundert Milliarden Euro vor. Die Idee wird es schon wesentlich länger gegeben haben; der Kriegsausbruch war aber eine passende Gelegenheit, sie der Öffentlichkeit vorzustellen.10 Das erforderliche Gesetz trat am 1. Juli 2022 in Kraft.11 Die Verwendung des Geldes ist im Wirtschaftsplan des Sondervermögens enthalten, der dem eigentlichen Gesetzestext als Anlage folgt.
Im Jahr 2022 sollten lediglich 90 Millionen Euro ausgegeben werden, dafür enthält das Gesetz eine Verpflichtungserklärung für künftige Jahre in Höhe von 81,91 Milliarden Euro. Dies ist einleuchtend, weil es etliche Jahre dauert, Rüstungsgüter zu entwerfen und zu bauen, sodass sich die investive Maßnahme über längere Zeiträume erstreckt. Ausgegeben werden insgesamt 82,02 Milliarden Euro für12
- Forschung, Entwicklung und Künstliche Intelligenz in 2022 fünf Millionen, in künftigen Haushaltsjahren 422 Millionen Euro,
- Beschaffung von Bekleidung und persönlicher Ausrüstung in 2022 45 Millionen, in künftigen Haushaltsjahren 1.932 Millionen Euro;
- Digitalisierung in 2022 zehn Millionen, in künftigen Haushaltsjahren 20.742 Millionen Euro;
- Ausrüstungen für die Landkriegsführung in 2022 zehn Millionen, in künftigen Haushaltsjahren 16.600 Millionen Euro;
- Ausrüstungen für die Seekriegsführung in 2022 zehn Millionen, in künftigen Haushaltsjahren 8.806 Millionen Euro;
- Ausrüstungen für die Luftkriegsführung in 2022 zehn Millionen Euro, in künftigen Haushaltsjahren 33.408 Millionen Euro.
- Die restlichen 17.980 Millionen Euro sind für Zinsen für die aufgenommenen Kredite verplant12.
Kritik
Etliche der vorgesehenen Projekte sind erst nach 2030 umsetzbar und auch erst in dieser Zeit vorgesehen, etwa das Main Ground Combat System für die Landstreitkräfte oder der Zulauf der U-Boote 212A CD bei den Seestreitkräften. Andere Projekte, wie die weiteren Korvetten K-130 oder die schweren Transporthubschrauber, waren Jahre vor dem Sondervermögen bereits bestellt. Billiger, weil es die Zinsen erspart hätte, wäre gewesen, den investiven Aufwand im laufenden Haushalt auf zehn Jahre zu verteilen. Damit hätte sich die Haushaltsposition militärische Beschaffungen dort zwar verdoppelt, was Einsparungen in anderen Teilen des Bundeshaushalts erforderlich gemacht hätte. Gerade dies soll offenbar vermieden werden. Vor allem aber war die Kreditaufnahme keineswegs erforderlich: Für die sogenannte Entwicklungshilfe werden jährlich über 28 Milliarden Euro ausgegeben und sind für die unmittelbar folgenden Jahre 68 Milliarden Euro eingeplant und versprochen. Dies sind 0,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, die gegen die Kritik, sie hätten für die Empfängerstaaten keinen Nutzen, ausgegeben werden, und auch Deutschland selbst daraus keinen Vorteil zieht (vgl. Kapitel Entwicklungspolitik). Diese Mittel lassen sich ohne Nachteil umwidmen.
Quellen und weiterführende Hinweise (letzter Abruf 8. Dezember 2024):
1 als PDF auf bmvg.de erhältlich gewesen, seit 2023 nicht mehr verfügbar.
2 Regierungsentwurf, übernommen von der Seite des Bundesrechnungshofs,
bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2022/entwicklung-einzelplan-14-bundeshaushalt-
2023.pdf?__blob=publicationFile&v=2.
3 de.statista.com/statistik/daten/studie/809435/umfrage/ausgaben-im-haushalt-des-ministeriums-fuer-verteidigung.
4 de.statista.com/statistik/daten/studie/150664/umfrage/anteil-der-militaerausgaben-am-bip-ausgewaehlter-laender.
5 Antwort der Bundesregierung vom 13. November 2020 auf Kleine Anfrage der FDP, Seite 4, Bundestagsdrucksache 19/24306
(online: dserver.bundestag.de/btd/19/243/1924306.pdf).
6 dazu ausführlich Teil 5 Organisationsbereiche, Kapitel Beschaffungsverwaltung.
7 bmvg.de/de/themen/verteidigungshaushalt/entwicklung-und-struktur-des-verteidigungshaushalts.
8 Vgl. die Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Diensts des Bundestags vom 9. Januar 2012 WD 4-3000-264-11.
9 dgap.org/de/forschung/expertise/zeitenwende.
10 Matthias Gebauer, Konstantin von Hammerstein, Die 100-Milliarden-Bazooka am 3. Januar 2022 in: Der Spiegel,
(online: spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-krieg-die-100-milliarden-dollar-bazooka-von-olaf-scholz-a-daf9203c-2737-4cb2-9c99-
308e50dea945).
11 Text auf gesetze-im-internet.de/bwfinsvermg/BwFinSVermG.pdf.
12 So in der Anlage zu § 5 BwFinSVermG mit einzelnen Beschaffungsvorhaben, Text siehe Fußnote 11.
Auslandseinsätze der Bundeswehr
Auslandseinsätze gab es immer. Vor der deutschen Wiedervereinigung waren es allerdings wenige, und in ihren ersten 34 Jahren beschränkte sich die Bundeswehr ausschließlich auf humanitäre Hilfe.1
- 1960: Katastrophenhilfe für die durch ein Erdbeben zerstörte marokkanische Stadt Agadir.
- 1965: Beteiligung an einer internationalen Hilfsaktion für Algerien mit einer Luftbrücke.
- 1976: Katastrophenhilfe im italienischen Erdbebengebiet Friaul.
- 1980: Katastrophenhilfe im italienischen Erdbebengebiet Materdomini.
- 1984: Transport von Versorgungsgütern in die Hungergebiete von Äthiopien.
- 1988: Transportflüge für die UN-Mission UNTAG nach Namibia (bis 1989).
- 1990: Katastrophenhilfe für den Iran nach einem Erdbeben.
Diese Unschuld ging mit dem Ende der alten Bundesrepublik noch zwei Monate vor der Wiedervereinigung verloren.
Golfkrieg 1990
Schon im August 1990 erfolgte im Auftrag der NATO eine indirekte Beteiligung am Zweiten Golfkrieg durch Entsendung von Minensuchbooten und Marineflugzeugen ins Mittelmeer und an den Persischen Golf und die Stationierung von Kampfflugzeugen zum Schutz der Türkei vor Angriffen aus dem Irak.2 Die auf die Wiedervereinigung fixierte deutsche Öffentlichkeit nahm dies so gut wie nicht zur Kenntnis. Klar war damit aber, dass Deutschland mit der Wiedervereinigung seine gänzliche militärische Zurückhaltung aufgeben würde, wofür die sogenannte Kohl-Doktrin im Voraus die Begrenzung festlegte, dass in jenen Ländern, die während des Nationalsozialismus von der Wehrmacht besetzt waren, nie mehr deutsche Soldaten präsent sein dürften.3
Erste Missionen
Die ersten Missionen, die die deutsche Öffentlichkeit bewusst zur Kenntnis nahm, bewegten sich strikt im Rahmen des Völkerrechts und setzten lediglich Aufträge der Vereinten Nationen um:
- 1991: Sanitätssoldaten unterstützen bis 1993 die UN-Missionen UNAMIC und UNTAC in Kambodscha.
- 1992: See-Embargo gegen Jugoslawien bis 1996 (NATO-Operation Sharp Guard).
- 1993: Teilnahme an der UN-Mission in Somalia.
- 1994: Teilnahme an der UN-Mission UNAMIR zur Versorgung ruandischer Flüchtlinge.
- 1994: Teilnahme an der UN-Mission UNOMIG zur Überwachung des Waffenstillstands in Abchasien (bis 2006).
Verfassungsrechtliche Beurteilung
Diese Missionen wurden in Politik und Gesellschaft scharf kritisiert. Über die verfassungsrechtlichen Bedenken entschied das Bundesverfassungsgericht am 12. Juli 1994,4 solche Einsätze seien zulässig, denn Art. 24 Abs. 2 des Grundgesetzes erlaube die Mitgliedschaft in der NATO und in den Vereinten Nationen, weshalb die Bundeswehr an deren militärischen Einsätzen teilnehmen dürfe, an bewaffneten Einsätzen allerdings nur, wenn der Bundestag zuvor zugestimmt hätte. Die Zweckbeschränkung für die Streitkräfte in Art. 87a GG stünde alldem nicht entgegen.

Deutsche UN-Soldaten beim Brunnenbohren 1993 in Somalia, Foto gemeinfrei
Jugoslawien
Gleich auf diese Entscheidung folgten Missionen, die bereits im Gegensatz zur Kohl-Doktrin standen, da sie vor allem auf dem Balkan stattfanden,3 der im 2. Weltkrieg von der Wehrmacht besetzt war.
- 1995: NATO-Operationen Deliberate Force, Joint Guard und Joint Forge zum Schutz der UN-Mission UNPROFOR und zur Stabilisierung in Bosnien-Herzegowina und Kroatien (bis 2004).
- 1997: Evakuierung von Zivilisten aus Albanien als NATO-Operation Libelle.
- 1999: Krieg der NATO gegen Jugoslawien, Besetzung des Kosovo (KFOR) und Schutz Albaniens (AFOR).
- 1999: Transportflüge nach Osttimor zur medizinischen Versorgung der UN-Mission INTERFET.
- 2000: UN-Mission UNMEE zu Überwachung von Waffenstillstandsabkommen in Äthiopien und Eritrea (bis 2008).
- 2001: Operation Essential Harvest in Mazedonien zur Entwaffnung albanischer Extremisten.
Davon stellte Jugoslawien 1999 eine Zäsur dar, denn dies war erstmals seit 1945 ein Kriegseinsatz.

Deutscher TORNADO über Jugoslawien, Foto gemeinfrei
Krieg gegen den Terror
Ab 2001 erfolgten fast alle Einsätze im Rahmen des von den Vereinigten Staaten ausgerufenen Kriegs gegen den Terror.5,6,7
- 2001: NATO-Operation Active Endeavour im Mittelmeer zum Schutz des Seeverkehrs gegen angebliche terroristische Bedrohungen (bis 2016).
- 2001: Beginn des Einsatzes in Afghanistan (bis 2021).
- 2002: NATO-Operation Enduring Freedom am Horn von Afrika (bis 2010).
- 2003: Einsatz von ABC-Abwehreinheiten in Kuwait während des Dritten Golfkriegs.
- 2003: EU-Operation Concordia in Mazedonien, Sicherung von EU- und OSZE-Beobachtern.
- 2003: Operation Artemis der Europäischen Union in Uganda zur Versorgung von Truppen in der Demokratischen Republik Kongo.
- 2004: Operation Althea der Europäischen Union in Bosnien-Herzegovina.
- 2004: Im Rahmen der African Union Mission in Sudan Lufttransport für Friedenstruppen der Afrikanischen Union in die Krisenregion Darfur (bis 2007).
- 2005: An der United Nations Mission in Sudan nehmen Militärbeobachter zur Überwachung des Friedensabkommens teil.
- 2005: Humanitäre Hilfe für Indonesien nach dem Seebeben im Indischen Ozean 2004.
- 2006: Minenräumung in Kambodscha (bis 2009).
- 2006: Deutsche Soldaten schützen im Kongo die Parlamentswahlen.
- 2008: Teilnahme an der Operation Atalanta der Europäischen Union zum Schutz von Hilfslieferungen nach Somalia und zur Bekämpfung der Piraterie (bis 2022).
- 2010: EU-Trainingsmission Somalia zur Ausbildung dortiger Sicherheitskräfte.
- 2011: Operation Pegasus zur Evakuierung von Zivilisten aus Libyen.
- 2012: Mission EUCAP zur Ausbildung somalischer Kräfte zur Piraterie-Bekämpfung (bis 2018).
- 2012: NATO-Operation Actice Fence zur Verteidigung des Bündnispartners Türkei (bis 2015).
- 2013: Beteiligung an der französischen Operation Serval und einer Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali (bis 2023).
- 2014: Schutz eines amerikanischen Spezialschiffs im Mittelmeer, auf welchem syrische Chemiewaffen vernichtet wurden (bis 2015).
- 2015: Ausbildungsunterstützung im Irak und für kurdische Peschmerga im Kampf gegen den Islamischen Staat.
- 2016: NATO-Operation Sea Guardian, Einsatz dauert derzeit (2024) noch an.
- 2017: NATO-Einsatz in Litauen im Rahmen der NATO Enhanced Forward Presence.
- 2020: EU-Operation Irini zur Durchsetzung des Waffenembargos gegen Libyen.
- 2021: Beteiligung an der Evakuierung von NATO-Truppen am Flughafen Kabul.
- 2021: Beteiligung am NATO Southern Air Policing in Rumänien (dauert an).
- 2023: Evakuierung aus Khartum wegen der Kämpfe im Sudan.
- 2023: Beteiligung an der europäischen Ausbildungsmission für Niger.
Ergebnisse
Seit 1992 kamen bei Auslandseinsätzen 116 Soldaten ums Leben. Davon fielen 37 durch Fremdeinwirkung und 22 starben durch Suizid.8,9 Die prägenden Einsätze zu Land waren die im Kosovo, in Afghanistan und in Mali.
- In Afghanistan ging es um amerikanische Interessen, nachdem die Vereinigten Staaten nach den Anschlägen vom 11. September 2001 den NATO-Verteidigungsfall ausgerufen hatten.
- Dasselbe trifft auf das Kosovo zu, wo die Vereinigten Staaten den großen Stützpunkt Camp Bondsteel einrichteten, um den Balkan dauerhaft militärisch kontrollieren zu können.
- In Mali ging es um französische Interessen, insbesondere um die Erhaltung des französischen Zugriffs auf Bodenschätze wie Uran, von dem die Energiewirtschaft Frankreichs abhängt10.
Um deutsche Interessen ging es bei keinem einzigen Einsatz. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung wurde auch weder am Hindukusch noch im Kosovo oder in Mali verteidigt. Abgesehen von Mali und Niger, wo es um französische Interessen ging, erfolgten die Einsätze der Bundeswehr ausschließlich in amerikanischem Interesse.
Quellen und weiterführende Hinweise (letzter Abruf 10. Dezember 2024):
1 de.wikipedia.org/wiki/Auslandseinsätze_der_Bundeswehr#Einsätze_begonnen_vor_1990.
2 de.wikipedia.org/wiki/Auslandseinsätze_der_Bundeswehr#Einsätze_begonnen_von_1990_bis_1999.
3 de.wikipedia.org/wiki/Kohl-Doktrin.
4 BVerfGE 90, Seite 286, online servat.unibe.ch/dfr/bv090286.html#.
5 de.wikipedia.org/wiki/Auslandseinsätze_der_Bundeswehr#Einsätze_begonnen_von_2000_bis_2009.
6 de.wikipedia.org/wiki/Auslandseinsätze_der_Bundeswehr#Einsätze_begonnen_von_2010_bis_2019.
7 de.wikipedia.org/wiki/Auslandseinsätze_der_Bundeswehr#Einsätze_begonnen_seit_2020.
8 bundeswehr.de/de/ueber-die-bundeswehr/gedenken-tote-bundeswehr/todesfaelle-bundeswehr.
9 Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage vom 4. Februar 2019, Bundestagsdrucksache 19/7778.
10 dgap.org/de/forschung/publikationen/krise-mali-frankreich-treibt-internationalen-einsatz-voran.
Verbündete
Im Rahmen der NATO hat Deutschland 31 Verbündete. Davon sind 28 europäische Staaten. Durch geografische Gegebenheiten verteilen sich diese auf drei große Räume, Nord-, Mittel- und Südeuropa, die durch natürliche Hindernisse voneinander getrennt sind: Zwischen Nord- und Mitteleuropa liegen Nord- und Ostsee. Zwischen Mittel- und Südeuropa verlaufen die Gebirgszüge der Pyrenäen, der Alpen und der Karpaten.

Karte: Topografie Europas, Urheber: San Jose, Europe topography map de.png
Politisch gehören 49 Staaten zu Europa. Soweit sie zur Europäischen Union gehören, fällt auf, dass die Staatsgebiete von Norden nach Süden und von Westen nach Osten immer kleiner werden.
Nordeuropa
Die drei nordeuropäischen Staaten Finnland, Schweden und Norwegen sind mittlerweile alle der NATO beigetreten. Ihre Staatsgebiete sind für europäische Verhältnisse sehr groß. Ihre relativ kleinen Staatsvölker befinden sich jedoch im Schrumpfen (die Fertilitätsrate liegt überall deutlich unter 2,1). Wirtschaftlich und technologisch stehen sie durchweg auf hohem Niveau.1
| Staat | Staatsgebiet
km² |
Bevölkerung
(Millionen) |
Einwohner
je km² |
BIP pro Kopf
US-Dollar |
Fertilitätsrate
2022 |
| Finnland | 338.472 | 5,5 | 16 | 53.557 | 1,4 |
| Norwegen | 385.207 | 5,5 | 14 | 105.826 | 1,4 |
| Schweden | 447.435 | 10,5 | 24 | 56.188 | 1,4 |
Der NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens hat in beiden Staaten nur skeptischen Rückhalt in der Bevölkerung2 und darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass alle drei Staaten militärisch nicht stark sind:
Wegen der geringen Bevölkerung organisieren sie ihre Verteidigung mit kleinen Berufsarmeen als Kadern, um den sich im Verteidigungsfall milizartige Heimwehren beträchtlicher Stärke formieren. 1939 konnte sich Finnland damit gegen den Angriff der Sowjetunion behaupten.3 Dass diese drei Staaten Landstreitkräfte über die Ostsee bringen, um an militärischen Auseinandersetzungen in Mitteleuropa teilzunehmen, ist bei dieser Organisationsform so gut wie ausgeschlossen.
Strategisch sind die drei nordeuropäischen Staaten für die NATO von erheblicher Bedeutung: Von Norwegens Küste aus lässt sich der Schiffsverkehr im Nordatlantik und im angrenzenden Teil des Arktischen Ozeans kontrollieren. Die Ostsee wird durch den Beitritt Schwedens und Finnlands von der NATO beherrscht. Von Finnland aus werden die Häfen der russischen Nordflotte im Weißen Meer und die zweitgrößte russische Stadt, Sankt Petersburg, bedroht, was in einem Krieg zwischen Russland und Europa russische Kräfte an der nördlichen Flanke binden würde.
Mitteleuropa
Der Raum zwischen Ostsee und Alpen veränderte sich durch den Zerfall der Sowjetunion 1991, die Auflösung der Tschechoslowakei 1992 und die bis 2000 andauernden Kriege im früheren Jugoslawien erheblich. Im östlichen Teil Mitteleuropas entstanden mit Estland, Lettland, Litauen, der Slowakei, Slowenien und Tschechien sechs neue Staaten, in denen seit ihrem Beitritt zur Europäischen Union politisch stabile Verhältnisse einzogen. Seitdem prägen den mitteleuropäischen Raum kleinere Staaten, während es dort nur noch Frankreich, Deutschland und Polen als große Flächenstaaten gibt.
| Staat | Staatsgebiet
km² |
Bevölkerung
(Millionen) |
Einwohner
je km² |
BIP pro Kopf
US-Dollar |
Fertilitätsrate
2022 |
| Belgien | 30.668 | 11,6 | 377 | 49.843 | 1,5 |
| Deutschland | 357.588 | 84,7 | 237 | 48.756 | 1,5 |
| Estland | 45.335 | 1,3 | 31 | 28.136 | 1,4 |
| Frankreich | 543.908 | 68,4 | 105 | 47.357 | 1,8 |
| Lettland | 64.594 | 1,9 | 31 | 21.947 | 1,5 |
| Litauen | 65.300 | 2,9 | 43 | 24.989 | 1,3 |
| Luxemburg | 2.586 | 0,7 | 255 | 126.598 | 1,3 |
| Niederlande | 41.543 | 17,9 | 423 | 57.428 | 1,5 |
| Österreich | 83.882 | 9,2 | 109 | 52.192 | 1,4 |
| Polen | 312.696 | 38,2 | 123 | 18.343 | 1,3 |
| Slowakei | 49.035 | 5,5 | 114 | 21.053 | 1,6 |
| Slowenien | 20.273 | 2,1 | 105 | 28.527 | 1,6 |
| Schweiz | 41.291 | 8,8 | 214 | 102.865 | 1,4 |
| Tschechien | 78.866 | 10,5 | 139 | 26.849 | 1,6 |
| Ungarn | 93.036 | 9,6 | 104 | 18.579 | 1,5 |
Von Westen nach Osten ist der mitteleuropäische Raum immer dünner besiedelt, und ebenfalls von Westen nach Osten lässt die Wirtschaftskraft nach. Wirtschaftlich sind Polen und Ungarn auf den beiden schlechtesten Plätzen und liegen – pro Kopf gerechnet – deutlich hinter den kleineren Staaten zurück. Die im Süden an Deutschland angrenzenden Staaten Österreich und Schweiz sind neutral. Alle übrigen Staaten des mitteleuropäischen Raums sind Mitglieder der NATO. In einem Krieg zwischen Russland und den europäischen Staaten wäre der östlichste Teil des mitteleuropäischen Gebiets der Kriegsschauplatz zu Land. Da in der Ostsee russischer Schiffsverkehr so gut wie nicht mehr stattfinden kann (siehe oben), sind Landungen russischer Truppen in anderen Teilen Mitteleuropas, etwa an deutschen Küsten, unvorstellbar geworden. Im Kalten Krieg galten sowjetische Landungsoperationen an deutschen und dänischen Küsten noch als sehr wahrscheinliches Szenario.
Südeuropa
Der Süden Europas zerfällt in drei Halbinseln, die historisch, sprachlich und kulturell sehr unterschiedlich geprägt sind.
Iberische Halbinsel: Spanien grenzt im Norden an Frankreich und im Westen an Portugal. Sonst haben Spanien und Portugal nur Seegrenzen. Beide Staaten sind NATO-Mitglieder. Ihre Mitgliedschaften sind für das Bündnis (bzw. für die Vereinigten Staaten) weniger von militärischem als geostrategischem Interesse. Die Landstreitkräfte beider Staaten sind Berufsarmeen von mäßiger Größe und für den Rest Europas praktisch ohne Bedeutung, auch wenn die NATO und die Europäische Union stets anderes behaupten.
Italische Halbinsel: Dort liegt nur der NATO-Staat Italien. Sein Kernland ist zum größeren Teil von Gebirgen geprägt, und sein 301.338 km² großes Staatsgebiet1 umfasst auch etliche Inseln, vor allem Sardinien und Sizilien. Organisation und Ausrüstung der italienischen Landstreitkräfte, einer Berufsarmee, sind auf diese Besonderheiten abgestimmt.6 Daher werden auch sie für andere Teile Europas bedeutungslos sein.
Balkanhalbinsel: Die Hälfte der dortigen Staaten ging zwischen 1992 und 2000 aus dem zerfallenen Flächenstaat Jugoslawien hervor. Bis auf Bosnien-Herzegowina, den Kosovo und Serbien sind alle Mitglieder der NATO. Militärisch bedeutend ist in dieser Region nur Griechenland, das gemessen an seiner Bevölkerungsgröße, seiner Wirtschaftskraft und seiner Landfläche außerordentlich große Streitkräfte unterhält.7 Dabei ist es militärisch ausschließlich auf die Türkei fixiert.8 Die übrigen Staaten des Balkans sind (mit Ausnahme Kroatiens) politisch nicht sehr stabil und wirtschaftlich unbedeutend. Militärisch bedeutungslos sind alle, auch Kroatien. Der Zerfall Jugoslawiens gereichte den Vereinigten Staaten zu einem strategischen Vorteil, da sie ab 2000 zur bestimmenden Ordnungsmacht der Balkanregion wurden: Im Kosovo unterhält die US Army einen ihrer größten Militärstützpunkte weltweit.9
Eine militärische Intervention von Landstreitkräften südeuropäischer Staaten zur Unterstützung Mitteleuropas darf aus verschiedenen Gründen als ausgeschlossen gelten: Es fehlt ihnen an Ausrüstung, an finanziellen Mitteln, logistischen Möglichkeiten – und vor allem am Anlass. Eine Pflicht oder gar einen automatischen Zwang, Deutschland und den mitteleuropäischen Staaten im Verteidigungsfall mit Truppen zu Hilfe zu eilen, geht vom Nordatlantikvertrag nämlich nicht aus (vgl. Teil NATO = Risiko, Kapitel Nordatlantikvertrag).
Vereinigte Staaten
Die amerikanischen Streitkräfte unterhalten in Deutschland zahlreiche Standorte, in denen etwa 39.500 Soldaten stationiert sind.10 Sie liegen vor allem im südlichen Teil des deutschen Staatsgebiets (vgl. Karte im Teil Risiko NATO). In etlichen anderen europäischen NATO-Staaten gibt es zwar amerikanische Stäbe und Verbindungsstellen, doch allenfalls noch Italien ist als Marine- und Luftwaffenstandort von ähnlicher strategischer Bedeutung für die Vereinigten Staaten. Wegen der Notwendigkeit, ihre Truppen aus Deutschland abzuziehen, würde ein NATO-Austritt Deutschlands eine erhebliche Schwächung der strategischen Position der Vereinigten Staaten in Europa bedeuten.
Quellen und weiterführende Hinweise (letzter Abruf 17. August 2024):
1 alle Zahlen nach den Einträgen auf de.wikipedia.com, Fertilitätsrate nach data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=FI.
2 Zustimmung in Schweden angeblich 51 Prozent: spiegel.de/ausland/schweden-mehrheit-spricht-sich-in-umfrage-fuer-nato-beitritt-aus.
Zustimmung in Finnland angeblich 52 Prozent: deutschlandfunk.de/tuerkei-nato-finnland-schweden-100.html.
3 de.wikipedia.org/wiki/Winterkrieg.
4 ejercito.defensa.gob.es.
5 exercito.pt/pt/meios.
6 esercito.difesa.it.
7 army.gr.
8 bpb.de/themen/europa/tuerkei/520903/hin-und-her-zwischen-entspannung-und-krise-griechisch-tuerkische-beziehungen.
freiheit.org/de/tuerkei/die-griechisch-tuerkischen-beziehungen-aus-griechischer-perspektive.
9 de.wikipedia.org/wiki/Camp_Bondsteel.
10 de.wikipedia.org/wiki/Ausländische_Militärbasen_in_Deutschland#Anzahl_der_Soldaten_ausländischer_Streitkräfte.
Reform- und Finanzierungsbedarf
Unter den in den vorangegangenen Kapiteln beschriebenen Verhältnissen wurde die Bundeswehr ab 2000 ein seltsames Gebilde, das völlig anders organisiert und ausgerüstet ist als die Streitkräfte aller übrigen Staaten weltweit: Dort kam bislang noch nie jemand auf die Idee, aus dem Sanitätsdienst, der Logistik und der Fernmeldetruppe gewissermaßen eigenständige Teilstreitkräfte zu formieren. Die Planer der Bundeswehr waren von 1950 an geschult, eine reine Defensivarmee zu organisieren, die nur im eigenen Land eingesetzt wird. In britischen oder amerikanischen Kategorien, wonach Streitkräfte in der Lage sein müssen, überall auf der Welt einzugreifen, dachten sie nicht. In musterschülerhaftem Eifer, eine Sache, von der man nichts versteht, dennoch besonders gut zu erledigen, vollendeten sie bis 2017 eine Struktur, bei der keine Armee mit eigenem Verteidigungsauftrag herauskam, sondern eine Art Dienstleistungsunternehmen zur Unterstützung anderer Streitkräfte. Dies deckte sich mit dem politischen Willen: In dieser Form ließen sich statt Kampftruppen vor allem Sanitäter, Informatiker und technisches Personal entsenden, womit sich die pazifistisch denkende deutsche Gesellschaft am ehesten abfinden konnte.
Zustand
Diese Reformen führten dazu, dass es in der Bundeswehr gleich viele Informationstechnikverbände wie Panzerverbände gibt, und dass die Zahl der Logistikverbände an die Zahl der Infanterieverbände heranreicht. Ihre Kriegsschiffe sind mittlerweile von enormer Größe, doch für einen Kampf gegen andere Kriegsschiffe sind sie viel zu schwach bewaffnet. Die Beschaffung von Kampfflugzeugen für die Luftwaffe wurde 2012 abgebrochen. Dafür gibt es reichlich Flugzeuge für die Luftbetankung anderer Flugzeuge, weltweite Evakuierungseinsätze unter intensivmedizinischer Betreuung und Transporte bis zum Äquator, und jeder neunte Soldat ist Arzt oder Sanitäter. Kampftruppen gibt es somit nur noch wenige, dafür aber umso mehr medizinisches und technisches Unterstützungspersonal.
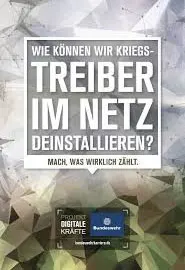
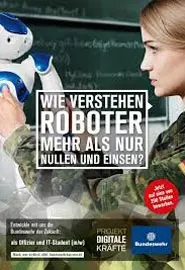

An diesem Selbstverständnis als Dienstleistungspool lässt die Bundeswehr auch in ihrer Personalwerbung keinen Zweifel und vermittelt dabei zugleich ein Bild vom Soldatenberuf, das nicht richtig ist. Dass es nicht richtig ist, merken neu eingetretene Soldaten schnell. 20 Prozent brechen deshalb ihre militärische Grundausbildung ab.1
Kritik aus Polen
Nachdem sich ab 2014 ein Konflikt mit Russland abzeichnete, äußerte Polen mehr und mehr Zweifel an der Verlässlichkeit, am Engagement und – vor allem – an den militärischen Fähigkeiten der Bundesrepublik Deutschland als Verbündetem. Da Polen wegen seiner geografischen Nähe zu Russland weitaus größere Verteidigungsanstrengungen unternimmt, bezeichnete der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki Deutschland 2019 sogar als verteidigungspolitischen Trittbrettfahrer.2 Das Kabinett Merkel IV überhörte die polnische Kritik jedoch geflissentlich. Unter dem Eindruck der russischen Invasion in der Ukraine 2022 beschloss Polen eine massive Modernisierung und Erweiterung seiner Streitkräfte. 4 bis 5 Prozent des polnischen Bruttoinlandsprodukts fließen mittlerweile in die Verteidigungsausgaben,3 und die bestellte Ausrüstung kann als gewaltig bezeichnet werden.4
Aus anderen europäischen Staaten kommt solche Kritik nicht, denn außer Polen und den baltischen Staaten scheint sich in Europa niemand ernsthaft vor Russland zu fürchten. Gewiss unternehmen seit 2022 fast alle europäischen Staaten wieder zusätzliche Verteidigungsanstrengungen, doch geht es überall nur um eine Modernisierung der Ausrüstung, jedoch nirgends um eine numerische Vergrößerung der Streitkräfte. Den Vereinigten Staaten ist dies dennoch recht: Ihre Rüstungsindustrie profitiert von der in Europa ausgebrochenen Angst vor Russland, und die Auftragsbücher der amerikanischen Rüstungsunternehmen sorgen bis zum Ende des Jahrzehnts für Auslastung.5
Kriegstüchtigkeit vs. Verteidigungsfähigkeit
Aus polnischer Sicht erwies sich diese Kritik mit der russischen Invasion in der Ukraine als berechtigt, und der 2023 ins Amt gekommene Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigte daraufhin an, die Bundeswehr kriegstüchtig zu machen. Die Truppen der Bundeswehr werden seitdem zweifellos kriegstüchtig gemacht, doch die Bundeswehr bleibt nach wie vor lediglich ein militärisches Dienstleistungsunternehmen für die NATO, nur mit dem Unterschied, dass ihre Landstreitkräfte im Verein mit den niederländischen Landstreitkräften nun zwei kriegstüchtige mechanisierte Divisionen beisteuern sollen. Der Krieg, für den die Bundeswehr ertüchtigt wird, ist ein Krieg der NATO gegen Russland.
Da ansonsten alles bleibt, wie es ist, wird die Bundeswehr bei dieser Art der Kriegstüchtigkeit auch weiterhin nicht in der Lage sein, den Bund zu verteidigen, wie es Artikel 87a Absatz 1 des Grundgesetzes vorsieht. Damit wurde Deutschland mit der Neuausrichtung der Bundeswehr 2011 noch enger in die NATO eingebunden als es zuvor jemals der Fall war.
Option: Neutralität
Pazifisten übersehen oft, dass Neutralität keineswegs mit friedlicher Waffenlosigkeit gleichzusetzen ist. Wenn ein Staat als neutral anerkannt werden will, muss er nicht nur auf Bündnisse verzichten, sondern zugleich glaubwürdig vorführen, dass er bereit und imstande ist, seine Neutralität notfalls auch zu verteidigen:6 Er muss in der Lage sein, andere Staaten davon abzuhalten, sein Staatsgebiet, seinen Luftraum sowie den zu seinem Staatsgebiet gehörenden Meeresraum im Kriegsfall zu durchqueren oder sich darin aufzuhalten. Die Schweiz verhielt sich in dieser Hinsicht während des 2. Weltkriegs rigoros, aber im Hinblick auf die Bewahrung ihrer Neutralität korrekt: Alliierte Flugzeuge, die die Strecke zwischen Italien und Deutschland über die Schweiz abkürzen wollten, wurden von ihr bekämpft; abgestürzte und notgelandete Flugzeugbesatzungen wurden interniert.7
Spielt man die denkbaren Szenarien nach einem NATO-Austritt durch, müsste die Bundeswehr in erster Linie in der Lage sein, die Streitkräfte der westeuropäischen NATO-Staaten davon abzuhalten, den Weg zu ihren osteuropäischen Verbündeten durch Deutschland zu wählen. Da diese Streitkräfte nicht groß sind, wird diese Aufgabe Deutschland nicht überfordern. Mit Russland müsste es die Bundeswehr dagegen nicht aufnehmen können: Russland liegt durch die politischen Verschiebungen nach dem Ende des Kalten Krieges etwa 1.000 Kilometer von der östlichen Außengrenze Deutschlands entfernt. Dazwischen liegen die Staatsgebiete Polens und Weißrussland, sodass Deutschland durch eine Neutralität – unfreiwillig – tatsächlich zum Trittbrettfahrer der polnischen Verteidigungsanstrengungen würde. Allein gegen Deutschland gerichtete russische Militäroperationen über die Nord- und Ostsee können aus russischer Sicht nicht erfolgversprechend sein; warum dies so ist, wird an anderer Stelle ausführlich erörtert. Insofern kann die Bundesrepublik die Neutralität ohne Risiko wagen.
Option: NATO ohne USA
Dem früheren Kanzlerkandidaten der SPD, Oskar Lafontaine, schwebt anstelle der NATO eine NATO ohne USA vor, also eine ausschließlich aus europäischen Staaten bestehendes Verteidigungsorganisation.8 Dies ist die wahrscheinlichere Folge eines deutschen NATO-Austritts, möglicherweise nach einem kurzen Verweilen in der Neutralität. Ein Rückzug auf dem Gebiet der Verteidigungspolitik auf ausschließlich nationale Belange verträgt sich kaum mit der Mitgliedschaft in der Europäischen Union, und mit einer deutschen Führungsrolle schon gar nicht. Welche Option am Ende die wahrscheinlichere und die klügere ist, braucht hier jedoch noch nicht erörtert zu werden: Beides ist besser als der Verbleib im Fahrwasser der amerikanischen Außenpolitik.
Veränderungsbedarf
Von beiden Optionen geht ein erheblicher Veränderungsbedarf der Bundeswehr aus. Für die Neutralität müsste aus einem pflichtschuldigen Kontingent für die NATO eine autarke Verteidigungsorganisation werden, und der Beitrag zu einer NATO ohne USA müsste so ausfallen, dass der bisher von den Vereinigten Staaten beigesteuerte Anteil ersetzt wird. Beide Ziele sind nur erreichbar, wenn die Bundeswehr ihre eigenartige Gesamtorganisation mit den Organisationsbereichen aufgibt (siehe oben) und sich wieder mit Teilstreitkräften für die Land-, Luft- und Seekriegsführung begnügt. Zweifellos wird es – wie fast in allen Streitkräften – weiterhin einen Teil der Gesamtorganisation geben, dessen Aufgaben nicht unmittelbar den Teilstreitkräften zugewiesen werden können.

Landstreitkräfte
Den weitesten Weg haben bei einer Reform die Landstreitkräfte vor sich, die von der Bundeswehr Heer genannt werden (dass dieser archaische Begriff alle Fortschreibungen des Traditionserlasses überlebt hat, ist für sich genommen erstaunlich). Eine personelle und materielle Vergrößerung des Heeres ist unvermeidlich. Den Veränderungsbedarf des Heeres erörtert die angehängte Abhandlung
PDF: Heer, 1,73 MB, 76 Seiten.
In der zusätzlichen PDF: Anhang_Heer, 240 KB, 42 Seiten,
sind sämtliche rechnerischen Untersetzungen zum Personal- und Ausrüstungsbedarf des Heeres enthalten, auf die im Text der Abhandlung Heer verwiesen wird. Deshalb empfiehlt sich eine gleichzeitige Lektüre beider Dateien.
Bereits an dieser Stelle lässt sich sagen, dass die personelle Vergrößerung des Heeres unterm Strich keinen zusätzlichen Personalbedarf der Bundeswehr hervorruft. Der größere Teil des Zuwachses kommt durch die Rückkehr seit Oktober 2000 ausgegliederter Truppen in das Heer zustande, die bei allen anderen europäischen Streitkräften selbstverständliche Bestandteile der Landstreitkräfte sind. Unterm Strich sind erforderlich
- zur personellen Ausstattung des Heeres aufgerundet 128.100 Soldaten,
- dazu rund 3.000 Beamte und Angestellte,
- zur Vergrößerung der Ausrüstung aufgerundet 15,5 Milliarden Euro.
Luftstreitkräfte
Bei der Luftwaffe sind die Schwierigkeiten eines NATO-Austritts ganz anderer Art. Sie ist der Widerhaken, der die Bundeswehr an die Vereinigten Staaten und damit an die NATO bindet, denn es besteht eine technische Abhängigkeit von amerikanischen Rüstungsprodukten und eine organisatorische Abhängigkeit von amerikanischer Ausbildungsunterstützung. Erschwerend tritt hinzu, dass es eine eigene deutsche Luftfahrtindustrie, die in der Lage wäre, Kampfflugzeuge zu bauen, nicht gibt.

Mehrere Dienstbereiche der Luftwaffe sind zudem rechtlich selbständige NATO-Institutionen, die zivilrechtliche Eigentümer der für sie angeschafften Flugzeuge sind. Ein Austritt aus der NATO bedeutet, dass die Bundesrepublik Deutschland den Zugriff auf diese Flugzeuge verliert, obwohl sie überall den größten Teil der Anschaffungskosten beigetragen hat. Die vielfältigen Auswirkungen eines NATO-Austritts auf die Luftstreitkräfte der Bundeswehr beschreibt die Abhandlung
PDF: Luftwaffe, 13,3 MB, 83 Seiten.
Es werden dort auch Lösungen vorgeschlagen. Untersucht werden auch die russischen Luftstreitkräfte im Hinblick auf das Narrativ von der angeblichen konventionellen Überlegenheit Russlands, die es in der Wirklichkeit aber nicht gibt. Unterm Strich sind für den NATO-Austritt erforderlich
- zur personellen Ausstattung der Luftwaffe aufgerundet 28.000 Soldaten, nicht mehr als jetzt,
- dazu weiterhin 4.800 Beamte und Angestellte,
- zur Ablösung amerikanischer Waffensysteme aufgerundet 15 Milliarden Euro.

Seestreitkräfte
Von allen drei Teilstreitkräften engagierte sich die Marine an den Auslandseinsätzen der Bundeswehr am stärksten. Dabei wurde aus strategischer und geografischer Sicht in den letzten 200 Jahren immer wieder über die Frage gestritten, ob Deutschland überhaupt Seestreitkräfte braucht, und welche Aufgaben sich einer deutschen Marine stellen. Ein NATO-Austritt wird diese Frage neuerlich aufwerfen. Nachgegangen wird ihr im Hinblick auf Personalbedarf und Ausrüstung der deutschen Seestreitkräfte in der
PDF: Marine, 5,37 MB, 79 Seiten.
Zur Erklärung der einzelnen Schiffsklassen und Seekriegsmittel haben wir noch die
PDF: Glossar_Seekriegsmittel, 3,49 MB, 12 Seiten.
angehängt, in der zugleich ein Eindruck von der amerikanischen Marine vermittelt und an ihrem Beispiel erläutert wird, wie eng Flottenrüstung und weltpolitische Gestaltung zusammenhängen. Unterm Strich sind bei der Marine für den NATO-Austritt erforderlich
- zur personellen Ausstattung aufgerundet 16.000 Soldaten, nicht mehr als jetzt,
- dazu wie bisher 1.800 Beamte und Angestellte,
- zur Erhaltung des Schiffsbestands und zur Ablösung amerikanischer Waffensysteme aufgerundet 5 Milliarden Euro.

Sonstige Streitkräfte
Es gibt auch nach einem NATO-Austritt eine Fülle militärischer Aufgaben, die nicht organisch in die Kompetenzbereiche der drei Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe und Marine fallen und auch untereinander grundverschieden sind. Ihr Bogen spannt sich vom
- militärischen Nachrichtenwesen über
- die Spionageabwehr,
- die Rüstungskontrolle,
- den Attaché-Dienst,
- die Cyber-Kriegführung,
- der Mitwirkung am diplomatischen Protokoll,
- den ortsgebundenen Sanitätsdienst,
- die Verwaltung der Truppenübungsplätze,
- die Logistik,
- die Sportausbildung,
- die Militärmusik
- bis zum Diensthundewesen.
Der Errichtung des Organisationsbereichs Streitkräftebasis im Jahr 2000 lag – unter anderem – die Vorstellung zugrunde, für diese sehr verschiedenartigen Truppen und Dienststellen einen eigenen organisatorischen Rahmen neben Heer, Luftwaffe und Marine zu schaffen. Dieser Ansatz ist nachvollziehbar, doch mit der Errichtung der weiteren Organisationsbereiche Zentraler Sanitätsdienst und Cyber- und Informationsraum wurde der Bogen der Idee überspannt. Die für einen NATO-Austritt erforderlichen Veränderungen auf diesen Aufgabenfeldern werden in der
PDF: Militärische_Organisationsbereiche, 2,65 MB, 81 Seiten,
erörtert, die nach der ab April 2025 geltenden offiziellen Bezeichnung dieses organisatorischen Rahmens benannt ist. Die Beibehaltung und erst recht die Erhebung des bisherigen Organisationsbereichs Cyber- und Informationsraum zur vierten Teilstreitkraft wird hier für falsch gehalten: Die mobilen Teile der Fernmeldetruppe und der Truppe für die elektronischen Kampfführung sollten wieder in das Heer zurückkehren, wonach von dieser vierten Teilstreitkraft wenig übrigbleiben würde. Dies ist aber eine organisatorische Frage, von der ein NATO-Austritt nicht abhängt.
Unterm Strich sind bei Umsetzung aller hier gemachten Vorschläge für eine eigenständige Verteidigungsorganisation außerhalb der Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe und Marine noch erforderlich
- aufgerundet 16.000 Soldaten, deutlich weniger als in der derzeitigen Organisationsform,
- dazu rund 9.000 Beamte und Angestellte,
- jedoch aufgrund der vorhandenen Ausstattung keine zusätzlichen finanziellen Aufwendungen.
Zivile Organisationsbereiche
Die drei Bundesoberbehörden, die das Personalwesen, das Beschaffungswesen sowie die Infrastruktur der Bundeswehr verwalten, werden in der
PDF: Zivile Organisationsbereiche, 4,92 MB, 46 Seiten.
erörtert. Zwar steht hier die bloße Beschreibung im Vordergrund, weil Artikel 87b des Grundgesetzes wenig Veränderung zulässt, doch erhält der sicher ganz überwiegende Teil der Leserschaft Einblicke in ein verwirrend organisiertes Geflecht von Behörden und privatrechtlich organisierten Gesellschaften, dessen sich die meisten Steuerpflichtigen noch nie bewusst geworden sein dürften.
Da das Bundesministerium der Verteidigung seit 2016 immer mehr Aufgaben an sich gezogen hat, ist es im Grunde zu einem vierten zivilen Organisationsbereich angewachsen. Es wird deshalb mitsamt seinem umfangreichen nachgeordneten Bereich ebenfalls dort beschrieben.
Unterm Strich sind in den drei zivilen Organisationsbereichen sowie im Bundesministerium der Verteidigung erforderlich
- aufgerundet 4.700 Soldaten,
- dazu 52.200 Beamte und Angestellte,
- jedoch keine zusätzlichen finanziellen Aufwendungen.
Der Übersichtlichkeit halber stellen wir den Bedarf an Personal und Geld an dieser Stelle tabellarisch zusammen:
| Organisationsbereich | Soldaten | Beamte
und Angestellte |
Zusätzliche
Ausgaben (Mrd. €) |
| Teilstreitkraft Heer | 128.100 | 3.000 | 15,5 |
| Teilstreitkraft Luftwaffe | 28.000 | 4.800 | 15,0 |
| Teilstreitkraft Marine | 16.000 | 1.800 | 5,0 |
| Militärische Organisationsbereiche | 16.000 | 9.000 | 0,0 |
| Zivile Organisationsbereiche | 4.700 | 52.200 | 0,0 |
| insgesamt | 192.800 | 70.800 | 35,5 |
Im Ergebnis vergrößert sich der Personalbedarf der Bundeswehr nur leicht von derzeit 185.000 auf rund 193.000 Soldaten. Die angedachte Vergrößerung auf 203.000 Soldaten erweist sich jedenfalls als nicht erforderlich, merkwürdiger Weise ohne NATO-Mitgliedschaft.
Der zusätzliche Bedarf an finanziellen Mitteln wirkt auf den ersten Blick mit fast 35,5 Milliarden Euro erschreckend hoch, erst recht, wenn man bedenkt, dass dies zum 2022 aufgelegten Sondervermögen von 100 Milliarden Euro erforderlich würde. In diesem Schreck darf allerdings Folgendes nicht übersehen werden:
- 13 der 100 Milliarden Euro des Sondervermögens sind Zinsen.9 Für Anschaffungen stehen somit in Wirklichkeit nur 87 Milliarden zur Verfügung. Hätte man die Anschaffungen nicht mit Kredit finanziert, sondern mit Haushaltsumschichtungen, etwa durch Beendigung der Entwicklungspolitik, für die im letzten Jahr insgesamt 33 Milliarden Euro ausgegeben wurden, würden diese Zinsen nicht anfallen. Zumal nicht alles, was bestellt wurde, auf einmal geliefert wird, sondern sich die Auslieferungen über etliche Jahre hinziehen, hätten sich die Ausgaben des Sondervermögens ohne weiteres durch Umschichtungen finanzieren lassen. Die Schuldenaufnahme war unnötig.
- Von den für den NATO-Austritt zusätzlich erforderlichen 35,5 Milliarden Euro erklärt sich mehr als ein Drittel durch die Notwendigkeit, amerikanische Rüstungsgüter durch deutsche oder europäische zu ersetzen sowie Ausbildungseinrichtungen aus den Vereinigten Staaten abzuziehen. Noch deutlicher: Etwa 12 Milliarden Euro wurden von der Regierung Scholz allein im amerikanischen Interesse ausgegeben, obwohl in Europa gleichwertige Produkte erhältlich waren. Die Ausgaben für zur Vermeidung technischer Abhängigkeiten nötige Ersatzbeschaffungen sind das Ergebnis einer verfehlten Industriepolitik.
- Der für die Marine bestimmte Teil dieser 35,5 Milliarden Euro, der sich mit 5 Milliarden sogar verhältnismäßig bescheiden ausnimmt, ist erst etwa 2040 aufzubringen und ist derzeit noch nicht relevant.
- Mit etwas Mut hätte sich somit eine eigenständige deutsche Verteidigungsorganisation bereits ab 2022 mit 120 statt 100 Milliarden Euro finanzieren lassen, und dies allein durch den Verzicht auf die Fortsetzung der unsinnigen Entwicklungspolitik. Mit einer Umwidmung des Geldes, das in 4 Jahren für Entwicklungspolitik ausgegeben wird, wäre alles bezahlt gewesen. Stattdessen wurden Schulden gemacht.
- So oder so: Entgegen den Narrativen der Transatlantiker ist ein NATO-Austritt durchaus erschwinglich. Der politische Gegenwert besteht in der Chance, aus dem Fahrwasser der immer gefährlicheren amerikanischen Außenpolitik herauszukommen und nicht mehr an Kriegen teilnehmen zu müssen, die die Bevölkerung zu jeder Zeit bereits mehrheitlich ablehnte. Im Verhältnis zum Schaden, den ein Krieg mit Russland in Deutschland anrichten würde, sind 35,5 Milliarden Euro fast schon eine Nebensächlichkeit.
Die Frage, ob ein NATO-Austritt diese 35,5 Milliarden Euro wert ist, muss sich jeder Leser an dieser Stelle selbst beantworten.
Quellen und weiterführende Hinweise (letzter Abruf 10. Dezember 2024):
1 instagram.com/soldatsein/p/CpLCECjNmA4.
2 n-tv.de/politik/Polen-moniert-deutsche-Militaerausgaben-article21222254.html.
3 europeannewsroom.com/de/polen-gibt-bereits-jetzt-gemessen-am-bip-am-meisten-fuer-verteidigung-unter-den-nato-laendern-aus,
polskieradio.pl/400/7764/artykul/3418986,verteidigung-rekordbudget-für-2025-geplant, euractiv.de/section/europa-kompakt/news/polen-strebt-noch-hoeheren-verteidigungshaushalt-an.
4 spiegel.de/ausland/polen-bestellt-tausend-panzer-und-dutzende-kampfflugzeuge-in-suedkorea-a-a7b19a7d-ed38-4d2b-a45f-f3cfa349894f.
5 fr.de/wirtschaft/groesste-ruestungskonzerne-einnahmen-2022-auftraege-aufruestung-ukraine-geopolitik-zr-92713457.html,
watson.ch/international/usa/615254031-ruestungsindustrie-in-den-usa-hohe-ausgaben-geringe-gewinne, marktundmittelstand.de/zukunftsmaerkte/waffenlieferanten-der-usa.
6 uni-heidelberg.de/md/zegk/histsem/mitglieder/wie_die_eidgenossen_ihre_neutralit__t_entdeckten.pdf.
7 suedkurier.de/ueberregional/panorama/Wie-sich-die-Schweizer-gegen-Luftraumverletzungen-wehrten;art409965,10099328,
srf.ch/kultur/der-archivar-abgeschossen-von-der-neutralen-schweiz,
nzz.ch/geschichte/wie-amerikanische-bomberpiloten-im-zweiten-weltkrieg-aus-der-schweiz-flohen-ld.1776352.
8 Oskar Lafontaine, Ami It’s time ti go, 2022,
Interview mit dem Autor: telepolis.de/features/Wir-brauchen-eine-Nato-ohne-die-USA-7365330.html?seite=all.
9 esut.de/2023/01/meldungen/39784/bundeswehr-sondervermoegen.
